Tierart: Hund
Rasse: Pekingese
QUEN-Merkblatt Nr. 30
Bearbeitungsstand: 05.06.2025
Tierart: Hund
Rasse: Pekingese
QUEN-Merkblatt Nr. 30
Bearbeitungsstand: 05.06.2025
1. Beschreibung der Tiere
FCI Rassestandard* Nr.: 207
Äußeres Erscheinungsbild und laut Standard geforderte, kritische Merkmale:
Pekingesen sind laut Rassestandard klein, kurz und dennoch stämmig. Schwere Knochen und ein stämmiger Körper sind essentielle Merkmale der Rasse. Sie weist einen ziemlich großen Kopf auf, im Verhältnis breiter als tief. Der Fang darf relativ kurz und breit sein. Eine kleine Falte kann von den Wangen bis zum Nasenrücken in einem breiten, umgekehrten „V” verlaufen. Hals, Körper sowie Gliedmaßen sind ziemlich kurz.
Rute: Hoch angesetzt und fest über dem Rücken leicht zur Seite getragen.
Gangbild: rollende Bewegung.
Laut Standard: „Nicht übermäßig behaart.“ (“Übermäßiges Haar muss streng bestraft werden”).
Es gibt Pekingesen in unterschiedlicher Haarart!
In dem Bestreben, mögliche Atemprobleme, die durch das flache Gesicht der Rasse verursacht werden, anzugehen, änderte der Kennel Club (UK) im Oktober 2008 den Rassestandard erheblich, indem er die Klausel strich, dass das „Profil flach sein sollte, wobei die Nase zwischen den Augen gut nach oben ragt“, und stattdessen hinzufügte, dass die „Schnauze deutlich sichtbar sein muss“. Dies war eine Reaktion auf die öffentliche Meinung nach der BBC-Sendung „Pedigree Dogs Exposed“.
Laut Welpenstatistik des VDH wurden im Jahr 2023 bei VDH-Züchtern 15 Pekingese-Welpen geboren. Die meisten Welpen dieser Rasse werden außerhalb der etablierten Verbände gezüchtet.
Aufgrund seines begehrten Aussehens wurde der Pekingese für die Entwicklung von Designer-Kreuzungen verwendet, wie z. B. für den Peekapoo (Kreuzung mit einem Pudel) und den Peke-a-tese (Kreuzung mit einem Malteser).
*Rassestandards und Zuchtordnungen haben im Gegensatz zu TierSchG und TierSchHuV keine rechtliche Bindungswirkung.
2.1 Bild 1

Pekingesen.
Foto: iStock
2.1 Bild 2

Pekingese.
Foto: QUEN-Archiv
3. In der Rasse häufig vorkommende Probleme/Syndrome
Von mehreren in dieser Rasse vorkommenden Problemen und möglicherweise auftretenden Erkrankungen werden an dieser Stelle nur die wichtigsten in der Rasse auftretenden Defekte aufgeführt.
Beim Pekingesen sind folgende rassetypische Defekte oder gehäuft vorkommende Probleme/Gesundheitsstörungen und Dispositionen bekannt:
- Brachycephalie
- BOAS (Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom)
- Augenerkrankungen
- Hautfaltendermatitis
- Geburtsschwierigkeiten (Dystokie)
- Wirbelsäulenerkrankungen (Bandscheibenerkrankungen (IVDD), Hemivertebrae)
- Chondrodysplasie und Chondrodystrophie
- Patellaluxation
- Zahnanomalien
4. Weitere ggf. gehäuft auftretende Probleme
In der veterinärmedizinischen Fachliteratur finden sich neben den unter Punkt 3 angegebenen rassetypischen Defekten Hinweise zum Vorkommen folgender Probleme, die nachfolgend nicht weiter ausgeführt werden, da noch keine abschließenden Schlussfolgerungen aus den bekannt gewordenen Prävalenzen gezogen werden können und durch Züchter, Zuchtvereine und -verbände keine unter wissenschaftlichen Kautelen erhobenen Prävalenzen angegeben werden. Für diese Fälle ist jedoch die folgende Aussage von Hale (2021) zutreffend: “The absence of evidence is not the evidence of absence”.
- Trachealkollaps
- Hydrocephalus
- kongenitaler portosystemischer Shunt
- atlantoaxiale Subluxation/Instabilität
- Kryptorchismus
- Nierensteine
- Urolithiasis
- Perinealhernie
- Mitralklappendysplasie
- Nekrotisierende Meningoencephalitis
- übermäßiges Fellwachstum (Beeinträchtigung der Thermoregulation)
5. Symptomatik und Krankheitswert einiger Defekte: Bedeutung/Auswirkungen des Defektes auf das physische/ psychische Wohlbefinden (Belastung) des Einzeltieres u. Einordnung in Belastungskategorie∗
∗ Die einzelnen zuchtbedingten Defekte werden je nach Ausprägungsgrad unterschiedlichen Belastungskategorien (BK) zugeordnet. Die Gesamt-Belastungskategorie richtet sich dabei nach dem jeweils schwersten am Einzeltier festgestellten Defekt. Das BK-System als Weiterentwicklung nach dem Vorbild der Schweiz ist noch im Aufbau und dient lediglich der Orientierung. Daher sind die hier vorgenommenen BK-Werte als vorläufig anzusehen. Dies vor allen Dingen deshalb, weil sich im deutschen Tierschutzgesetz keine justiziable Grundlage zur Einteilung in Belastungskategorien findet. Im Gegensatz zur Schweiz, werden in den gesetzlichen Normen in Deutschland Schmerzen, Leiden oder Schäden nicht quantifiziert oder ihrer Qualität nach beurteilt, sondern diese berücksichtigt, wenn sie das Tier mehr als nur unwesentlich beeinträchtigen. Die Belastungskategorien können aber ggf. auch zur Beurteilung einer Zucht- und Ausstellungseignung herangezogen werden.
Die Belastungen, welche durch Defekt-Zuchtmerkmale entstehen können, werden in 4 Kategorien eingeteilt (Art. 3 TSchZV, Schweiz). Für die Zuordnung eines Tieres zu einer Belastungskategorie ist das am stärksten belastende Merkmal oder Symptom entscheidend (Art. 4 TSchZV, Schweiz).
Kategorie 0 (keine Belastung): Mit diesen Tieren darf gezüchtet werden.
Kategorie 1 (leichte Belastung): Eine leichte Belastung liegt vor, wenn eine belastende Ausprägung von Merkmalen und Symptomen bei Heim- und Nutztieren durch geeignete Pflege, Haltung oder Fütterung, ohne Eingriffe am Tier und ohne regelmäßige medizinische Pflegemaßnahmen kompensiert werden kann.
Kategorie 2 (mittlere Belastung): Mit diesen Tieren darf ggf. nur gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt.
Kategorie 3 (starke Belastung): Mit diesen Tieren darf nicht gezüchtet werden.
Brachycephalie (siehe auch Merkblatt Nr. 8 Hund Brachycephalie)
Physisch:
Der Pekingese gehört zu den brachycephalen Hunderassen. Die zuchtbedingten Veränderungen des Schädels, die mit der Brachycephalie einhergehen, fassen Geiger et al. (2021) in ihrer ausführlichen Übersicht zusammen. Charakteristisch ist der kurze und runde Schädel mit flacher Schnauze und kurzer Nase. Durch die Reduktion der knöchernen Maxilla schlägt die darüber befindliche Haut Falten. Fehlender Platz im Maul führt zu häufig auftretender Oligodontie und Zahnfehlstellungen wie rotierten Zähne.
Aus Untersuchungen bei brachycephalen Rassen ist bekannt, dass der Tränennasengang durch die zuchtbedingte Veränderung des Gesichtsschädels häufig missgebildet und in seinem Verlauf stark abweichend ist. Er ist oft in der Länge erheblich reduziert und kann eine starke Steilstellung aufweisen. In vielen Fällen besitzen die Tränennasengänge der betroffenen Tiere eine zusätzliche Öffnung, durch welche die Flüssigkeit auch in den hinteren Teil der Nasenhöhle ablaufen kann. Zur Behandlung einer auftretenden Epiphora (Auslaufen von Tränenflüssigkeit über den Lidrand) kann ein chirurgischer Eingriff, die mediale Kanthoplastik, notwendig sein, um die Lidränder zu kürzen und die Reibung durch Haare zu unterbinden.
Der allgemeine Gesundheitszustand von brachycephalen Hunderassen ist im Vergleich zu nicht-brachycephalen Rassen schlechter. Brachycephale Hunde erkranken häufiger und weisen ein höheres Risiko für verschiedene Erkrankungen auf. Die Lebenserwartung von brachycephalen Rassen ist im Vergleich zu meso- und dolichocephalen Hunden reduziert. Als Gründe dafür werden die mit der Brachycephalie assoziierten Prädispositionen, wie BOAS, Wirbelsäulenerkrankungen und weitere Auffälligkeiten vermutet. Der Pekingese hatte allerdings in der zitierten Schweizer Studie eine ähnliche Lebenserwartung wie Mischlingshunde.
Psychisch:
Im Vergleich zu Rassen ohne extreme Schädelform scheinen brachycephale Rassen deutlich häufiger von verschiedenen Erkrankungen betroffen zu sein. Die Schädelveränderungen haben dazu geführt, dass die Längen der Muskeln im Verhältnis zum Schädel verändert sind, sodass die Mimik der Tiere und somit die Kommunikation mit Artgenossen und Menschen beeinträchtigt ist. Eine Übersichtsarbeit geht auf die Auswirkungen auf das Verhalten der Hunde ein. Neben einem eingeschränkten Ausdrucksverhalten und Sozialverhalten ist beispielsweise auch die Aktivität der Tiere aufgrund der beeinträchtigten Atmung und Thermoregulation eingeschränkt, sodass sich diese nicht mehr “normal” verhalten können.
Viele Verhaltensweisen und Lebensbereiche der Tiere werden durch die Brachycephalie und daraus folgende Erkrankungen negativ beeinflusst. Es kann bei der Futteraufnahme zu Atemnot kommen. Betroffene Tiere benötigen meist nach aktiven Phasen eine längere Erholungsphase. Das Spielen mit Artgenossen kann eingeschränkt sein. Insgesamt kann daher davon ausgegangen werden, dass die Lebensqualität deutlich vermindert ist.
Belastungskategorie: 3
BOAS (Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom)
Physisch:
Übersichtsarbeiten wie von Meola (2013) beschreiben die für brachycephale Rassen, wie den Pekingesen, typischen anatomischen und physiologischen Grundlagen des Brachycephalen Obstruktiven Atemwegssyndroms (BOAS) und deren Folgeerscheinungen. Zu den primären Komponenten gehören kongenitale anatomische Merkmale wie stenotische Nasenlöcher, ein verlängerter weicher Gaumen, eine hypoplastische Luftröhre und nasopharyngeale Turbinate. Erhöhte Turbulenzen und ein erhöhter Atemwiderstand können zur Entwicklung sekundärer Veränderungen führen. Dazu gehören Gaumen- und Kehlkopfödeme, Schwellungen, ausgestülpte Saccula und Tonsillen (saccule and tonsil eversion) sowie ein Kehlkopfkollaps, die alle zu einer lebensbedrohlichen Beeinträchtigung der Atmung führen können.
Ein begünstigender Faktor für das BOAS ist die Brachycephalie. Pekingesen weisen durch den verkürzten Schädel ein relativ verlängertes Gaumensegel im Vergleich zu nicht-brachycephalen Hunden auf. Zudem ist das Gaumensegel verdickt. Der Raum bzw. das Volumen des Nasopharynx ist hingegen signifikant verkleinert. Das Risiko für BOAS sinkt mit zunehmender relativer Schnauzenlänge. Bei kleinerem kraniofazialem Verhältnis (Division der Schnauzenlänge durch die Schädellänge), wie es bei brachycephalen Rassen üblich ist, steigt im Vergleich zu Rassen mit anderen Schädelformen das Risiko für BOAS. Weitere Risikofaktoren können der Halsumfang, Übergewicht und eine erfolgte Kastration sein.
Betroffene Hunde zeigen neben typischen Schnarchgeräuschen auch Belastungsintoleranz, Dyspnoe, Würgen, Regurgitieren, Erbrechen, Stridor und Synkopen. Hinzu kommt eine gestörte Thermoregulation. Neben dem Schnarchen während des Schlafens ist das BOAS außerdem durch chronische Kurzatmigkeit und daraus entstehende Schwierigkeiten bei der Bewegung sowie verstärkte und abnormale Atemgeräusche.
Wegen ihres üppigen Fells ist es wichtig, Pekingesen kühl zu halten. Die Rasse ist anfällig für einen Hitzschlag, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
Obstruktionen der oberen Atemwege können zu weiteren sekundären Komplikationen wie Aspirationspneumonien und nicht-kardialen Lungenödemen führen. Bei anderen brachycephalen Rassen konnten kollabierte Bronchien beobachtet werden, die mit dem erhöhten Atemwiderstand in Verbindung gebracht werden. Bei gravierender klinischer Symptomatik müssen die Tiere mittels Intubation, Sauerstoff, Abkühlen und/oder Sedation therapiert werden. Chirurgische Korrekturen der anatomischen Veränderungen können ebenfalls indiziert sein.
Untersuchungen bei anderen brachycephalen Rassen zeigten morphologische und funktionelle Veränderungen des Herzens, die mit den charakteristischen anatomischen Veränderungen bei den Rassen in Verbindung gebracht werden und nicht vom Vorhandensein von Symptomen abhängig sind.
Der Gastrointestinaltrakt ist bei vielen Hunden mit BOAS ebenfalls betroffen. Endoskopische und histologische Untersuchungen zeigten Veränderungen im Ösophagus, Magen und Duodenum.
Psychisch:
Betroffene Hunde sind täglich oder sogar mehrfach täglich durch Atemprobleme in ihrer Aktivität bzw. Bewegung beeinträchtigt. BOAS kann zu lebensbedrohlichen Atemwegsobstruktionen führen. Verschiedene operative Eingriffe können beim BOAS indiziert sein und dienen dazu, die Atemwegsobstruktionen zu beheben und die Lebensqualität der Hunde zu verbessern. Vor allem die postoperative (Aufwach-)Phase ist besonders riskant und benötigt intensive Beobachtung und Pflege. Die Auswertung verschiedener Studien zeigte, dass eine vollständige Behebung der Probleme jedoch nicht zwangsläufig eintreten muss. Es kann eine Verbesserung, aber keine vollständige Normalisierung der Atmung erwartet werden.
Belastungskategorie: 3
Augenerkrankungen
Physisch:
Viele der Augenerkrankungen werden durch die anatomischen Veränderungen in der okulofazialen Schädelregion der brachycephalen Hunde verursacht. Einige der häufigsten klinischen Anzeichen stehen in direktem Zusammenhang mit den morphologischen Veränderungen selbst, wie Entropium und Trichiasis. Andere sind sekundär erworben, darunter Hornhautulzerationen. Beim Pekingesen können neben Hornhautulzerationen und Keratokonjunktivitis sicca auch Irisprolaps und ein vorgetriebener Augapfel (Proptosis) beobachtet werden. Die Rasse besitzt mit einer Prävalenz von über 30% den größten mittleren relativen Lidspalt der in einer britischen Studie untersuchten Hunderassen und damit eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung an Hornhautulzerationen. Das Genetics Committee des American College of Veterinary Ophthalmologists (ACVO) führt beim Pekingesen Distichiasis, Entropium und Katarakt an. Aufgrund inadäquaten Blinzelns kann das “exposure keratopathy syndrome” auftreten, das eine Hornhauterkrankung beschreibt, die zu starken Augenreizungen führen kann.
Pekingesen gehörten in einer retrospektiven US-amerikanischen Studie zu den fünf häufigsten von Augenerkrankungen betroffenenen brachycephalen Rassen.
Ulcerative Keratitis
Die meisten Hunde mit einer ulzerativen Keratitis werden im Alter von unter 3 Jahren vorgestellt. In einer retrospektiven Studie aus Südkorea lag der Pekingese im Vergleich betroffener Hunderassen mit einem Anteil von 25 % (8 Hunde) auf Platz 2. Dort entwickelten mehr als die Hälfte der betroffenen Hunde tief reichende Hornhautulzerationen. Die schwedische Tierversicherung AGRIA berichtet in ihrem Breed-Report (2016-2021) von einem doppelt so großen relativen Risiko für ein Auftreten von Augenerkrankungen beim Pekingesen im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen dort versicherten Rassen. Das Risiko, an einer Hornhautulzeration zu erkranken, war sogar 5-fach höher als beim Durchschnitt der anderen Rassen. Beim Pekingesen treten häufig schwere Formen der ulzerativen Keratitis auf. Begünstigende Faktoren für Hornhautulzerationen sind vor allem die Brachycephalie, aber auch das Vorliegen einer Nasenfalte, die zu anhaltender Reizung der Hornhaut durch den Kontakt mit Haaren führen kann. Für Hunde mit Nasenfalte wurde ein fünfmal höheres Risiko für Hornhautulzerationen beschrieben. Auch die Breite der Lidspalte sowie die Sichtbarkeit der Sklera begünstigen Hornhautulzerationen. Die einzelnen Faktoren sind allerdings z.T. miteinander assoziiert und treten parallel auf. Für brachycephale Hunde mit einem kraniofazialen Verhältnis <0,5 ist das Risiko für Hornhautulzerationen sogar zwanzigmal höher als bei nicht-brachycephalen Rassen. Der Pekingese, der von diesem erhöhten Risiko betroffen ist, weist laut Packer et al. ein kraniofaziales Verhältnis von durchschnittlich 0,12 auf. Das kraniofaziale Verhältnis beschreibt die Schnauzenlänge, dividiert durch die Schädellänge und quantifiziert den Grad der Brachycephalie.
Bakterielle Keratitis
Der Pekingese gehörte bei der Auswertung von Labordaten in den USA mit 26 % (22 Hunde) zu den meistbetroffenen Rassen, bei denen eine bakterielle Keratitis diagnostiziert wurde. Es wird davon ausgegangen, dass die protektiven Mechanismen des Auges bei brachycephalen Rassen beeinträchtigt sind und beispielsweise Exophthalmus, Hautfalten und Entropium bakterielle Keratitiden begünstigen. Am häufigsten werden S. intermedius, β-hämolytische Streptococcus spp. und P. aeruginosa isoliert.
Pigmentkeratopathie/ Keratitis pigmentosa
Der Pekingese wird bei der Pigmentkeratopathie als gehäuft betroffene Rasse beschrieben. Ca. 12% der untersuchten Hunde waren in einer Studie des ACVO von der Erkrankung betroffen. Eine andere Studie mit vier Pekingesen konnte dies hingegen nicht bestätigen. Die Pigmentierung ist in der ophthalmologischen Untersuchung zu erkennen, geht mit einer Entzündung einher und kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Bei anderen Rassen, wie dem Mops, werden daraus resultierende Seheinschränkungen beschrieben.
Entropium (siehe auch Merkblatt Hund Augen Entropium)
Das Auftreten eines Entropiums wird meist mit den charakteristischen Schädelveränderungen bei brachycephalen Rassen assoziiert und beim Pekingesen beschrieben. Im Rahmen einer vergleichenden Studie verschiedener Rassen konnte dies für den Pekingesen allerdings nicht nachvollzogen werden. Als mögliche Gründe wurden hier die geringe Anzahl involvierter Hunde und eine im Vergleich zu anderen brachycephalen Rassen abweichende Morphologie der Nase bei Pekingesen angeführt.
Weitere Augenerkrankungen
Weitere bei der Rasse beobachtete Augenerkrankungen sind die Keratokonjunktivitis sicca, die ohne klinische Symptome auftreten kann oder mit Hyperämie, Blepharospasmus und/oder Keratitis einhergeht, sowie die “Sudden acquired retinal degeneration” (SARD). Der Pekingese gehört außerdem zu den Hunderassen, bei denen ein primäres Glaukom beobachtet werden kann. Der Anteil betroffener Hunde betrug einer Studie mit insgesamt 1562 Pekingesen im Zeitraum zwischen 1994 und 2002 zufolge bis zu 1,22 %. Von einer primären Katarakt waren Zahlen aus Nordamerika über fast vier Jahrzehnte zufolge 2,14 % der Pekingesen betroffen.
Psychisch:
Einige Augenerkrankungen, wie Keratokonjunktivitis sicca können schmerzhaft und sehr unangenehm für die Hunde sein, die dadurch leiden. Nozizeptive afferente Nervenzellen innervieren die Hornhaut, sodass davon auszugehen ist, dass ulzerative Veränderungen erhebliche Schmerzen verursachen. Um das Wohlbefinden zumindest kurzfristig zu verbessern und die auftretenden Erkrankungen zu korrigieren, werden z.T. chirurgische Eingriffe, wie die mediale Kanthoplastik, durchgeführt, wenn auch die primären oder morphologisch bedingten Anomalien nicht behoben werden können. Viele Anomalien können langfristig zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens führen.
Belastungskategorie: 2-3
Hautfaltendermatitis
Physisch:
Hauterkrankungen stellen mit einer Häufigkeit von 14,08 % den größten Anteil der Erkrankungen brachycephaler Rassen dar. In einer Übersicht zu dermatologischen Auffälligkeiten bei brachycephalen Rassen wird die Hautfaltendermatitis (Intertrigo) als ein häufiges Problem beschrieben. Pekingesen zählen zu den besonders betroffenen Rassen. Die Verkürzung des Schädels führt zu einer Faltung der überschüssigen Haut um die Schnauze, die Augen und die Ohren. Reduzierte Luftzirkulation, dadurch erhöhte Temperatur, Feuchtigkeit und Ablagerungen in den Hautfalten führen zusammen mit intermittierender Reibung und Irritation zu einer Überwucherung durch Kommensalen (Keime, die zur physiologischen Hautflora gehören) und zur Produktion von Toxinen, die zu Entzündungen, Mazerationen und Infektionen führen. Die betroffenen Bereiche weisen Erytheme, Hypotrichose, Alopezie, Erosionen/Ulzerationen, Krustenbildung, Lichenifikation (flächenhafte lederartige Veränderung der Haut), Pigmentveränderungen, Anhäufung von Talgablagerungen (keratosebaceous debris) und einen typischen schlechten Geruch auf. In schweren Fällen, in denen eine tiefe Pyodermie vorliegt, kann außerdem eine systemische antimikrobielle Therapie angezeigt sein.
Psychisch:
Die betroffenen Hautareale sind schmerzhaft und belasten dadurch die Tiere. Da die entzündlichen Veränderungen zwischen Hautfalten entstehen, kann die Erkrankung zunächst unbemerkt bleiben, wodurch eine lindernde Behandlung verzögert wird. Ist ein chirurgischer Eingriff nicht möglich, kann eine lebenslange Behandlung mit topischen Präparaten erforderlich sein.
Belastungskategorie: 2-3
Chondrodysplasie und Chondrodystrophie
Physisch:
Chondrodysplasie und Chondrodystrophie umfassen eine gestörte Knorpel- und Knochenentwicklung, die sich unter anderem durch verkürzte Beine auszeichnet und beim Pekingesen auftritt. Ein genauerer Überblick über die pathologischen Veränderungen bei chondrodystrophen Rassen kann Smolders et al. (2012) entnommen werden. Bei Rassen wie dem Pekingesen ist eine Kleinwüchsigkeit mit verkürzten Knochen der Gliedmaßen und der Wirbelsäule genetisch fixiert und im Rassestandard vorgegeben. Bei chondrodystrophen Rassen kann eine starke Prädisposition für Bandscheibenerkrankungen (Intervertebral Disc Degeneration) beobachtet werden. Klinisch äußert sich ein Bandscheibenvorfall in Form von Paraplegien mit oder ohne Nozizeption, Paraparesen, Ataxien oder spinaler Hyperästhesie. Die Symptome können akut oder chronisch auftreten (siehe auch Wirbelsäulenerkrankungen).
Obwohl es sich bei der Chondrodysplasie und der Chondrodystrophie um zwei getrennte Defekte handelt, werden sie an dieser Stelle zusammen erwähnt, weil beide Defekte beim Pekingesen vorkommen. Eine Differenzierung kann mittels Gentest erfolgen.
Psychisch:
Beim Auftreten von Begleiterkrankungen, wie Bandscheibenvorfällen, sind die betroffenen Hunde in ihrem Bewegungsverhalten durch Lähmungen und/oder Ataxien eingeschränkt. Die Symptome können sich zunehmend verschlechtern und mitunter werden die Hunde euthanasiert oder versterben. Neben neurologischen Dysfunktionen können Schmerzen auftreten, die das Wohlbefinden der Hunde negativ beeinflussen.
Belastungskategorie: 2-3
Wirbelsäulenerkrankungen (Bandscheibenerkrankungen (IVDD), Hemivertebrae)
Physisch:
Pekingesen weisen eine erhöhte Prädisposition für das Auftreten von Bandscheibenerkrankungen (IVDD) auf. Im Vergleich zu anderen Rassen und Mischlingen wurden in Untersuchungen aus Tschechien bzw. den USA Anteile von 4,67 % (N=300) bzw. 20,59 % (N=4491) ermittelt. Das relative Risiko für Pekingesen, an Bandscheibenerkrankungen zu erkranken, liegt beim 3,5 – fachen und ist damit im Vergleich zu 84 getesteten anderen Rassen signifikant erhöht. Das deckt sich mit der Erkenntnis, dass besonders kleine Rassen von Bandscheibenerkrankungen betroffen sind. Auch andere Studien beschreiben ein gehäuftes Auftreten und in einer Studie aus Korea mit geringeren Tierzahlen waren 42,5 % der betroffenen Hunde Pekingesen. Im Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA besaßen Pekingesen zwischen 2016 und 2021 ein 4,5-fach erhöhtes relatives Risiko für die Entwicklung von Bandscheibenerkrankungen im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Rassen.
Besonders häufig sind die Bereiche der thorakalen (T12-13) und der lumbalen (L3-4) Bandscheiben betroffen. Auch andere Studien stellten Bandscheibenextrusionen (Bandscheibenvorfälle) besonders im thorakolumbalen Bereich (T12-13) und zusätzlich im cervikalen Bereich bei C6-7 oder C2-3 und dahinter befindlichen Zwischenwirbelbereichen fest. Anhand von MRT-Befunden werden vier Arten von thorakolumbaler IVDD unterschieden: Bandscheibendegeneration, Bandscheibenvorwölbung, Bandscheibenprotrusion und Bandscheibenextrusion.
Beim Vergleich verschiedener, vorwiegend kleiner Hunderassen befand sich der Pekingese bei thorakalen Bandscheibenvorfällen mit einem Anteil von 3,6 % von insgesamt 165 Hunden auf dem vierten Platz. Bei cervikalen Bandscheibenvorfällen befand sich die Rasse an sechster Stelle mit einem Anteil von 3,8 %. Das Durchschnittsalter der vorgestellten Pekingesen in einer Klinik in Israel lag bei 5 Jahren. In dieser Studie war der radiografische Nachweis von verkalkten Bandscheiben ein starker Risikofaktor für IVDD bei den untersuchten Hunden und erhöhte die Wahrscheinlichkeit dieser Erkrankung um das 21-fache. Klinisch reichen die Symptome von leichtem Unbehagen ohne neurologische Defizite bis zu Paralysen mit Verlust des Schmerzempfindens. Meist tritt die Klinik jedoch akut mit Schmerzen und progressiver Myelopathie auf.
Bei chondrodystrophen Rassen, wie dem Pekingesen, treten auch Hemivertebrae gehäuft auf. Sie können sowohl uni- als auch bilateral in Erscheinung treten.
Psychisch:
Wirbelsäulenerkrankungen, wie Bandscheibenerkrankungen, können für die betroffenen Hunde sehr schmerzhaft sein, ihr Verhalten aufgrund von neurologischen Defiziten wie Lähmungen erheblich einschränken und das Wohlbefinden negativ beeinflussen.
Belastungskategorie: 2-3
Geburtsschwierigkeiten (Dystokie)
Physisch:
Kleine Rassen sind besonders von Geburtsschwierigkeiten betroffen. Eine schwedische Studie verweist auf ältere Untersuchungen, bei denen der Pekingese zu den Rassen mit signifikant erhöhtem Risiko für Dystokien gehörte. Die Kontraktionen verlaufen dabei nicht wie gewohnt oder der Geburtsverlauf ist gestört. Wenn die Dystokie nicht medikamentös behandelt werden kann, müssen die Welpen durch Sectio entwickelt werden. Der Pekingese gehört mit einer Kaiserschnittrate von 43,8 % zu den zehn Rassen, bei denen infolge von tatsächlichen oder erwarteten Geburtsschwierigkeiten am häufigsten eine chirurgische Intervention notwendig wird, um das Leben der Welpen und der Hündin nicht zu gefährden. Bei kleinen Rassen sinkt die Wurfgröße (Anzahl der Welpen) und gleichzeitig ist die relative Größe der Welpen im Vergleich zur Hündin erhöht. Eine Übersichtsarbeit zu rassespezifischen Erkrankungen zitiert Studien, die das Missverhältnis zwischen großem Kopf und breiter Schulter der Welpen und einem zu engen Becken der Mutterhündin (feto-pelvines Missverhältnis) besonders bei brachycephalen Rassen beschreiben, welches mit Geburtsschwierigkeiten verbunden sein kann. Geburtsschwierigkeiten können so zu einem Notfall werden, der riskant für die Hündin und die Welpen ist.
Psychisch:
Ein Kaiserschnitt kann das maternale Verhalten beeinflussen. Die vaginozervikale Stimulation scheint eine wichtige Rolle für das maternale Verhalten zu spielen, da man beobachtet, dass Hündinnen mit Kaiserschnitt ohne Einleitung einer natürlichen Geburt Probleme haben können, adäquate Interaktionen mit ihren Welpen zu entwickeln.
Belastungskategorie: 3
Patellaluxation
Physisch:
Das Risiko für Pekingesen, eine Patellaluxation zu entwickeln, ist im Vergleich zu anderen Rassen 1,4-fach bis 2,1-fach erhöht. Bei der Auswertung von klinischen Daten zu Patellaluxationen sind Pekingesen regelmäßig vertreten.
Die Ursache für eine Luxation (Herausspringen) der Kniescheibe liegt in einer Achsenfehlstellung der Hinterbeine. Bei kleinen Rassen liegt meist eine mehr oder weniger ausgeprägte Biegung der Knochen des Oberschenkels und des Schienbeins vor, welche oft zu einer O-Beinigkeit führt. Infolge der Verbiegung der Beinachse kommt es durch den Muskelzug an der Patellasehne zu einem Zug an der Kniescheibe nach innen, was zu deren Herausspringen nach innen führen kann. Die mediale Luxation (Ausrenkung nach innen) stellt die häufigste Form dar, wenngleich auch ein Herausspringen nach außen vorkommt. Für die Einteilung der Patellaluxation in Schweregrade siehe DiDona et al., 2018, und OFA, 2024.
Psychisch:
Die Hunde zeigen in höherem Stadium Lahmheiten, ggf. Osteoarthritis und Schmerzen, die viele Verhaltensweisen negativ beeinflussen und somit ihr Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen können.
Belastungskategorie: 2-3
Zahnanomalien
Physisch:
Zahnanomalien treten sowohl bei brachycephalen als auch bei kleinwüchsigen Rassen gehäuft auf. Bei Pekingesen wurde im Vergleich von insgesamt 208 Hunden mit Zahnanomalien ein Anteil von 15,4 % festgestellt, sodass sich die Rasse hier an vierter Stelle von insgesamt neun Rassen befand. Kleine Rassen, wie der Pekingese, sind häufiger betroffen als große Rassen. Die drei am häufigsten festgestellten Anomalien sind Hyperdontie, persistierende Milchzähne und Prognathie. Eine andere Studie zeigte hingegen ein signifikant geringeres Risiko für persistierende Milchzähne bei Pekingesen im Vergleich zu anderen besonders kleinen Hunderassen. Kleine brachycephale Rassen weisen im Vergleich zu nicht-brachycephalen Rassen aufgrund ihrer Schädelanatomie vermehrt Zähne auf, die nicht durchbrechen.
Psychisch:
Die Zähne dienen der Futteraufnahme, dem Kauen sowie dem Ausdrucksverhalten und der Körperpflege, die bei Veränderungen entsprechend eingeschränkt sein können.
Belastungskategorie: 2-3
Fazit:
Beim Pekingesen ergeben bereits die rassebedingten (standardbedingten) Ausgangswerte die Gesamt-Belastungskategorie 2-3.
Tierethische Bewertung der Qualzuchtproblematik beim Pekingesen
Auf Basis der im QUEN-Merkblatt Nr. 30 genannten Fakten, welche die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von zuchtbedingten Defekten der Belastungskategorien 2-3 (mittlere bis starke Belastung) bzw. 3 (starke Belastung) auflisten, ist aus tierethischer Sicht festzustellen, dass die Weiterzucht mit betroffenen Tieren dieser Rasse als höchst problematisch einzustufen ist, da ein Züchter davon ausgehen muss, dass Tiere, die er durch seine Zucht in die Welt setzt, erheblich und andauernd Schmerzen ertragen müssen oder leiden werden. Dies ist bereits dann inakzeptabel, wenn zumindest einer der im gegenständlichen Merkblatt genannten zuchtbedingten Defekte in den Belastungskategorien 2-3 bei mindestens einem der von ihm gezüchteten Tiere in vorhersehbarer Weise eintritt, wobei „vorhersehbar“ erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann vorliegen, wenn sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen erwartbar auftreten.
6. Vererbung, Genetik, ggf. bekannte Gen-Teste, ggf. durchschnittlicher genomischer Inzuchtkoeffizient (COI) und durchschnittlicher Heterozygotiewert für die Rasse
Brachycephalie
Das verantwortliche Gen bzw. die verantwortlichen Gene sind nicht vollständig geklärt. Aufgrund der genetischen Komplexität wird angenommen, dass verschiedene Chromosomen einen Einfluss haben. Es besteht eine starke Assoziation zum CFA1-Gen. Es wird vermutet, dass das TCOF1-Gen ebenfalls an der Ausbildung der Brachycephalie beteiligt ist. Auch eine Beteiligung von SMOC2- und BMP3-Genen wird diskutiert.
Chondrodysplasie und Chondrodystrophie
Chondrodysplasie ist vor allem in den kurzbeinigen Rassen bekannt und wird autosomal dominant vererbt. Es konnte ein Zusammenhang zwischen der Chondrodysplasie und dem Retrogen FGF4, das sich auf dem CFA18-Gen (Chromosom 18) befindet, nachgewiesen werden.
Chondrodystrophie wird im Hinblick auf die Beinlänge semi-dominant vererbt, d.h. heterozygote Hunde haben kürzere Beine als homozygot freie Hunde, während homozygot betroffene Hunde nochmals kürzere Beine haben als heterozygote. Genomstudien bei Nova Scotia Duck Tolling Retrievern konnten die Chondrodystrophie mit dem Retrogen FGF4 auf dem CFA12-Gen (Chromosom 12) in Verbindung bringen. Ein Gentest ist verfügbar.
Wirbelsäulenerkrankungen
Das IVDD-Risiko wird autosomal dominant vererbt, d.h. bereits eine Kopie des veränderten Chromosoms erhöht das Risiko signifikant. Ein Gentest ist verfügbar.
Weitere für die Rasse verfügbare Gentests
Degenerative Myelopathie (DM) Exon 2
Hyperurikosurie
Maligne Hyperthermie
Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA)
Der durchschnittliche genomische* Inzuchtkoeffizient beim Pekingesen liegt bei über 30%.
Grundlage einer verantwortungsvollen Zucht ist bei der sorgfältigen Diagnose des Einzeltieres nicht nur die Beurteilung des Exterieurs und der Verhaltenseigenschaften der Zuchtpartner vor dem ersten Zuchteinsatz, sondern auch die Nutzung moderner molekulargenetischer Diagnostik. Innerhalb eines Screenings sollte diese nicht nur zur Identifizierung von Merkmals- oder Anlageträgern, sondern auch zur Bestimmung des Inzuchtgrades des Einzeltieres genutzt werden. Inzwischen bieten Labore sogenannte „Matching Tools” oder „Mating Scores“ an, welche Züchter nutzen können, um geeignete Zuchtpartner zu identifizieren, wobei gleichzeitig die Verpaarung von Tieren mit gleichen risikobehafteten Anlagen verhindert werden kann. Verschiedene spezialisierte Labore bieten für Züchter entsprechende Beratungen an.
* der nach Abstammung/Ahnentafel berechnete Koeffizient ist nicht ausreichend präzise.
7. Diagnose-notwendige Untersuchungen vor Zucht oder Ausstellungen
Achtung: Invasive, das Tier belastende Untersuchungen sollten nur in begründeten Verdachtsfällen bei Zuchttieren durchgeführt werden und nicht, wenn bereits sichtbare Defekte zum Zucht- und Ausstellungsverbot führen.
Brachycephalie
Neben der adspektorischen Untersuchung zur Feststellung von Veränderungen der Kopfform, der Nasenlöcher und des Kiefers sind meist weitere fachtierärztliche Untersuchungen sowie bildgebende Verfahren zur Untersuchung des Kopfes und, bei einigen Tieren, des Skelettsystems notwendig, um dem jeweiligen Tier ggf. notwendige medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Mittels Bildgebung wie der Endoskopie können Stenosen, Verengungen im Nasenvorhof, Überlänge und Verdickung des weichen Gaumens, Veränderungen der Luftröhre sowie übermäßiges Gewebe im Nasen-/Rachen-/Maulraum festgestellt werden.
Mithilfe geprüfter Messverfahren kann die Brachycephalie anhand des kraniofazialen Verhältnisses quantifiziert werden. Dazu wird die Schnauzenlänge durch die Schädellänge dividiert. Die Messungen können an Röntgenbildern des Schädels vorgenommen werden.
BOAS (Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom)
Die Diagnose basiert auf den Berichten der Tierhalter*innen, der klinischen Untersuchung und diagnostischer Bildgebung. Problematisch ist, dass Tierhalter*innen klinische Symptome zwar bemerken, häufig aber nicht als Problem wahrnehmen bzw. als “normal” für die Rasse/den Hund einschätzen. Schnarchen, inspiratorische Dyspnoe, Zyanose und in schweren Fällen synkopale Episoden werden am häufigsten berichtet. Die Nasenlöcher können durch Adspektion auf die Ausprägung einer Stenose untersucht werden. Genauere Einschätzungen sind mittels Fotografien und Messungen möglich. Weiterführende bildgebende Verfahren wie MRT ermöglichen eine genauere Beurteilung der oberen Atemwege. Neben den verengten Nasenlöchern kann bei der Inspektion eine gewisse Atemanstrengung mit Bauchatmung festgestellt werden. Während das Schnarchen höchstwahrscheinlich durch Luftturbulenzen im oro-pharyngealen Bereich verursacht wird, ist das hohe Geräusch, das mit einer extremen Inspirationsanstrengung einhergeht, auf eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Atemwege zurückzuführen, wenn die turbulente Luft durch den kollabierten Larynx oder Nasopharynx strömt. Bei stabilen Patienten sollte die Lungenfunktion mittels Auskultation, Pulsoxymetrie und Blutgasanalyse überprüft werden. Pneumonien und Lungenödeme können röntgenologisch diagnostiziert werden.
Augenerkrankungen
Es wird eine vollständige ophthalmologische Untersuchung durchgeführt, unter anderem inklusive Schirmer-Tränentest, Tonometrie, Ophthalmoskopie und weiteren diagnostischen Verfahren je nach Verdachtsdiagnose.
Hautfaltendermatitis
Es wird eine klinische und dermatologische Diagnostik eingeleitet.
Chondrodysplasie und Chondrodystrophie
Zur Beurteilung von häufig auftretenden Bandscheibenerkrankungen sind neben einer neurologischen Untersuchung und Einstufung der Klinik bildgebende Verfahren einzusetzen (siehe auch Wirbelsäulenerkrankungen), wie z.B. CT (und Myelographie).
Wirbelsäulenerkrankungen
Zur Diagnostik gehören eine Anamnese, eine klinische neurologische Untersuchung und bildgebende Verfahren, wie Röntgen, CT und/oder MRT sowie weitere biochemische und histologische Diagnostik. Röntgendiagnostik kann Auskunft darüber geben, ob Verkalkungen an extrudierten Bandscheiben vorliegen.
Geburtsschwierigkeiten (Dystokie)
In der Anamnese wird geschildert, dass die Hündinnen Geburtsanzeichen zeigen, wie beispielsweise Nestbauverhalten, Vulvalecken und Laktieren, aber die Geburt nicht einsetzt. Außerdem können die Hündinnen starke oder unregelmäßige Kontraktionen zeigen. Bildgebung, wie Röntgenbilder und/oder Ultraschall, kann Aufschluss über die Lage und den Zustand der Welpen geben sowie mögliche Beckenfrakturen bei der Hündin offenbaren.
Patellaluxation
Es ist eine klinische Untersuchung durchzuführen, um auch den Grad der Luxation einschätzen zu können. Teil der orthopädischen Untersuchung ist auch die Beurteilung des Ganges. Bildgebende Verfahren, wie Röntgen oder CT, ermöglichen eine genauere Beurteilung.
Die Erkrankung kann meistens schon bei der Untersuchung ausreichend diagnostiziert werden. Auch wenn schon alleine bei der Palpation die Diagnose gestellt werden kann, ist die Anfertigung eines Röntgenbildes empfehlenswert. Einerseits können dadurch Arthrosen nachgewiesen werden, welche bei längerem Bestehen der Erkrankung auftreten. Andererseits können so andere Differentialdiagnosen ausgeschlossen und der Grad der Fehlstellung erkannt werden.
Zahnanomalien
Neben einer adspektorischen Beurteilung der Zähne und des Gebisses sind bildgebende Verfahren hilfreich. Übliche Dentalröntgen sind möglich, genauere Beurteilungen sind aufgrund der Schädelveränderungen bei brachycephalen Rassen mithilfe von Cone-Beam-Tomographien (Dental CBCT) möglich.
8. Aus tierschutzfachlicher Sicht notwendige oder mögliche Anordnungen
Entscheidungen über Zucht- oder Ausstellungsverbote sollten im Zusammenhang mit der Belastungskategorie (BK) getroffen werden. Ausschlaggebend für ein Zuchtverbot kann je nach Ausprägung und Befund der schwerste, d.h. das Tier am meisten beeinträchtigende Befund und dessen Einordnung in eine der Belastungskategorien (BK) sein, oder auch die Zusammenhangsbeurteilung, wenn viele einzelne zuchtbedingte Defekte oder rassetypische Prädispositionen vorliegen. Berücksichtigt werden sollte ggf. auch der individuelle genomische Inzuchtkoeffizient eines Tieres und die Eigenschaft als Trägertier für Risiko-Gene.
Generell sollte auch bei der Zucht von Pekingesen beachtet werden:
Neben zu beachtenden äußerlichen, anatomischen und funktionellen Merkmalen sowie des Verhaltens beider Zuchtpartner, sollten die Möglichkeiten zuchthygienischer Beratung auf molekulargenetischer Ebene genutzt werden und insbesondere der genetische Inzuchtkoeffizient, der Heterozygotiewert und die Dog Leukocyte Antigene (DLA) für die Rasse bestimmt werden. In zunehmendem Maß können auch sogenannte Matching Tools/Scores die Auswahl geeigneter Zuchtpartner erleichtern.
a) notwendig erscheinende Anordnungen
Zuchtverbot gem. §11b TierSchG für Tiere mit vererblichen/zuchtbedingten Defekten der Belastungskategorien 2 und 3, insbesondere mit
- Veränderungen des Skelettsystems: Kopf, Wirbelsäule, Hüfte, Becken, Gliedmaßen
- Brachycephalem Obstruktivem Atemwegs-Syndrom (BOAS)
- Augenerkrankungen
- verkürztem Oberkiefer, Fehlstellungen der Zähne (insbesondere sichtbare Zähne bei geschlossenem Maul) oder Malokklusion, Fehlen oder Querstellung von Molaren
Ausstellungsverbot gem. § 10 TierSchHuV bei Tieren sicher mit Veränderungen ab der Belastungskategorie 3, evtl. aber auch mit BK 2.
Ausstellungsverbot insbesondere für Tiere mit übermäßigem Haarwuchs und Felldichte.
b) mögliche Anordnungen
- Anordnung zur dauerhaften Unfruchtbarmachung (Sterilisation/Kastration) gemäß 11b (2)
- Nutzung moderner molekulargenetischer Diagnostik zur Bestimmung des genomischen Inzuchtkoeffizienten und des Heterozygotiewertes beider Elterntiere, falls gezüchtet werden soll.
Bitte beachten:
Maßnahmen der zuständigen Behörde müssen erkennbar geeignet sein, auch in die Zukunft wirkend Schaden von dem betroffenen Tier und/oder dessen Nachzucht abzuwenden. Es handelt sich im Hinblick auf Art und Bearbeitungstiefe von Anordnungen und Zucht- oder Ausstellungsverboten immer um Einzelfallentscheidungen im Ermessen der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen Normen und der vor Ort vorgefundenen Umstände.
9. Allgemeine tierschutzrechtliche Bewertung
a) Deutschland
Aus rechtlicher Sicht sind Hunde mit den oben beschriebenen Defekten/ Syndromen in Deutschland gemäß §11b TierSchG als Qualzucht einzuordnen.
Begründung:
Gem. §11b TierSchG ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht bei der Nachzucht oder den Nachkommen u.a.
Gem. § 11b TierSchG ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht bei der Nachzucht oder den Nachkommen u.a.
- erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 1 TierSchG) oder
- die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt (§ 11b Abs. 1 Nr. 2 c TierSchG).
Schmerz definiert man beim Tier als unangenehme Sinneswahrnehmung, verursacht durch tatsächliche oder potentielle Verletzung, die motorische oder vegetative Reaktionen auslöst, in einem erlernten Vermeidungsverhalten resultiert oder die potentiell spezifische Verhaltensweisen verändern kann (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, § 1 Rn. 12 mwN; grds. auch Lorz/Metzger TierSchG, § 1 Rn. 20)[110,111]. Oder kürzer die „International Association for the Study of Pain“ (IASP) als: „eine unangenehme sensorische und gefühlsmäßige Erfahrung, die mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigung verbunden ist oder dieser ähnelt” (https://www.iasp-pain.org/wp-content/uploads/2022/04/revised-definition-flysheet_R2-1-1-1.pdf).
Leiden sind alle nicht bereits vom Begriff des Schmerzes umfassten Beeinträchtigungen im Wohlbefinden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeitspanne fortdauern (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, § 1 Rn. 19 mwN; Lorz/Metzger, § 1 Rn. 33 mwN). Auch Leiden können physisch wie psychisch beeinträchtigen; insbesondere Angst wird in der Kommentierung und Rechtsprechung als Leiden eingestuft (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, § 1 Rn. 24 mwN; Lorz/Metzger, § 1 Rn. 37).
Ein Schaden liegt vor, wenn der körperliche oder seelische Zustand, in welchem ein Tier sich befindet, vorübergehend oder dauernd zum Schlechteren hin verändert wird (Hirt/Maisack/Moriz/Felde, § 1 Rn. 27 mwN; Lorz/Metzger, § 1 Rn. 52 mwN), wobei völlig geringfügige Beeinträchtigungen, basierend auf körperlicher oder psychischer Grundlage, außer Betracht bleiben. „Der Sollzustand des Tieres beurteilt sich an Tieren der gleichen Art. Das Fehlen von Körperteilen wird dabei in der Kommentarliteratur regelmäßig als Schaden bewertet“ (VG Hamburg Beschl. v. 4.4.2018, 11 E 1067/18 Rn. 47, so auch Lorz/Metzger TierSchG Komm. § 1 Rn. 52).
Die Zucht von Pekingesen erfüllt den Tatbestand der Qualzucht im Falle des Vorliegens der unter Ziffer 5 im Detail erläuterten Defekte:
- Brachycephalie und damit verbundene Schmerzen und Leiden (siehe hierzu auch Merkblatt “Hund Brachycephalie”)
- BOAS und damit verbundene Schmerzen und Leiden
- Augenerkrankungen und damit verbundene Schmerzen, Leiden und Schäden (siehe hierzu auch Merkblatt “Hund Entropium”)
- Hauterkrankungen und damit verbundene Schmerzen und Leiden
- Schäden an Wirbelsäule und damit verbundene Schmerzen und Leiden
- Chondrodysplasie
- Unfähigkeit oder häufige, deutliche Beeinträchtigung , auf natürliche Weise Nachkommen zu gebären
- Schäden an den Gliedmaßen (Patellaluxation)
- Zahnanomalien
- Beeinträchtigung der Thermoregulation und damit verbundenes Leiden
- durch Atemnot verursachte Angstzustände
- Leiden durch eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit
- Leiden infolge körperlicher Veränderungen, die zu einer nicht unwesentlichen Beeinträchtigung der arteigenen Verhaltensabläufe und ggf. Nicht-Belastbarkeit der Tiere führen. Ein artgerechtes Leben ist so nicht unwesentlich beeinträchtigt und das Wohlbefinden stark eingeschränkt.
- 11b Abs. 1 TierSchG sieht vor, dass für den Züchter züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht eine in § 11 b Abs. 1 genannte Folge eintritt. Abzustellen ist dabei gemäß der Gesetzesbegründung „auf wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, d.h. Erkenntnisse, deren Kenntnis von einem durchschnittlich sachkundigen Züchter erwartet werden können“ (vgl. BT-Drs. 17/10572, S. 31). Züchterische Erkenntnisse liegen vor, wenn aufgrund allgemein zugänglicher Quellen (insbes. Stellungnahmen von Zuchtverbänden, Fachzeitschriften, -büchern und tierärztlichen Gutachten sowie dem Qualzuchtgutachten des BMEL) bestimmte Erfahrungen mit der Zucht bestimmter Tierrassen bestehen, die sich wegen ihrer Übereinstimmung zu annähernd gesicherten Erkenntnissen verdichten (Lorz/Metzger, Kommentar zum TierSchG § 11b TierSchG Rn. 11)[111]. Das Qualzuchtgutachten des BMEL nennt den Pekingesen ausdrücklich unter den betroffenen Rassen bei folgenden Qualzuchtmerkmalen: Brachycephalie, Chondrodysplasie, Faltenbildung.
Das Zuchtverbot des § 11b TierSchG gilt unabhängig davon, ob der Züchter selbst die Möglichkeit der schädigenden Folgen erkannt hat, sondern stellt darauf an, ob die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen von einem sorgfältigen Züchter der jeweiligen Tierart erwarten werden können (vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, Kommentar, § 11b TierSchG Rn. 6).
Ein wichtiges Indiz für einen erblichen Defekt ist, dass eine Erkrankung oder Verhaltensabweichung bei verwandten Tieren häufiger auftritt als in der Gesamtpopulation der Tierart Hund. Gegen einen Schaden spricht nicht, dass sich die Rasse oder Population über längere Zeit als lebensfähig erwiesen hat (vgl. Lorz/Metzger Kommentar zum TierSchG § 11b Rn. 9).
Ein Zuchtverbot liegt nicht nur dann vor, wenn mit Tieren gezüchtet wird, die selbst qualzuchtrelevante Merkmale aufweisen (Merkmalsträger), sondern auch dann, wenn bekannt ist oder bekannt sein muss, dass ein zur Zucht verwendetes Tier Merkmale vererben kann (Anlageträger), die bei den Nachkommen zu einer der nachteiligen Veränderungen führen können (Lorz/Metzger, Kommentar zum TierSchG § 11b Rn. 6 mit weiterem Nachweis).
Vorhersehbar sind erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann, wenn sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen erwartbar auftreten (vgl. Goetschel in Kluge § 11b Rn. 14).
b) Österreich
Hunde mit den o. beschriebenen Defekten/ Syndromen sind in Österreich gemäß §5 TSchG als Qualzucht einzuordnen
Gegen § 5 des österreichischen TschG verstößt insbesondere*, wer „ Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen“.
*Das Wort “insbesondere” bedeutet, dass die Liste nicht vollständig, sondern beispielhaft ist. Das bedeutet, dass auch andere als die in §5 aufgezählten Merkmale und Symptome, so sie zu zuchtbedingten Veränderungen, die mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sein können, führen, als Qualzuchtmerkmale gewertet werden.
Verkürzung des Gesichtsschädels: Die Zucht mit Hunden, die unter einer Verkürzung des Gesichtsschädels und den damit verbundenen Problemen leiden oder dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 aufgezählte Symptome verwirklicht sind: Atemnot, Fehlbildungen des Gebisses.
Ektropium bzw. Entropium: Die Zucht mit Hunden, die unter pathologischen Veränderungen der Augen leiden oder dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: Entzündungen der Lidbindehaut und/oder der Hornhaut, Blindheit.
Wirbelkörpermalformationen sowie Chondrodystrophie/Chondrodysplasie, Intervertebral Disc Disease: Die Zucht mit Hunden, die unter pathologischen Veränderungen der Wirbelsäule und der Gliedmaßen leiden oder dazu genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: Bewegungsanomalien, neurologische Symptome.
Entzündungen der Haut aufgrund des dichten üppigen Fells oder Hautfaltendermatitis: Die Zucht mit Hunden, die unter Hautfaltendermatitis leiden oder dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, da folgendes in § 5 aufgezähltes Symptom verwirklicht ist: Entzündungen der Haut.
Schwergeburten/Kaiserschnitte: Die Zucht von Pekingesen ist bereits aufgrund der Tatsache als Qualzucht zu qualifizieren, dass mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden muss, dass natürliche Geburten nicht möglich sind.
c) Schweiz
Wer mit einem Tier züchten will, das ein Merkmal oder Symptom aufweist, das im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu einer mittleren oder starken Belastung führen kann, muss vorgängig eine Belastungsbeurteilung vornehmen lassen. Bei der Belastungsbeurteilung werden nur erblich bedingte Belastungen berücksichtigt (vgl. Art. 5 Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten [TSchZV]). Hunde mit Defekten, die der Belastungskategorie 3 zuzuordnen sind, unterliegen gemäß Art. 9 TSchZV einem Zuchtverbot. Ebenso ist es verboten, mit Tieren zu züchten, wenn das Zuchtziel bei den Nachkommen eine Belastung der Kategorie 3 zur Folge hat. Mit Tieren der Belastungskategorie 2 darf gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt (Art. 6 TSchZV). Anhang 2 der TSchZV nennt Merkmale und Symptome, die im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu mittleren oder starken Belastungen führen können. Degenerative Gelenkveränderungen, Schädeldeformationen mit behindernden Auswirkungen auf die Atemfähigkeit, die Lage der Augen, die Zahnstellung und den Geburtsvorgang, übermäßige Faltenbildung, Bandscheibenvorfälle, Fehlfunktionen der Augen sowie Katarakt und Entropium werden ausdrücklich erwähnt. Zudem werden gemäß Art. 10 TSchZV einzelne Zuchtformen ausdrücklich verboten. In den übrigen Fällen wird ein Zuchtverbot jedoch nur im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung ausgesprochen. Tiere, die aufgrund unzulässiger Zuchtziele gezüchtet wurden, dürfen nicht ausgestellt werden (Art. 30a Abs. 4 Bst. b TSchV).
d) Niederlande
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” des Tierhalter-Dekrets verboten, mit Haustieren in einer Weise zu züchten, die dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Elterntiere oder ihrer Nachkommen abträglich ist.
In jedem Fall muss die Zucht so weit wie möglich verhindern, dass
- schwerwiegende Erbfehler und Krankheiten an die Nachkommen weitergegeben werden oder bei ihnen auftreten können;
- äußere Merkmale an die Nachkommen weitergegeben werden oder sich bei ihnen entwickeln können, die schädliche Folgen für das Wohlbefinden oder die Gesundheit der Tiere haben.
Folgende Erbkrankheiten oder Anomalien gemäß Artikel 3.4. sind beim Pekingesen verwirklicht: Brachycephalie, Erkrankungen des Auges, Anomalien der Wirbelsäule, unnatürliche Fortpflanzung (Dystokie), Patellaluxation.
Es können u.a. folgende schädliche äußere Merkmale an die Nachkommen von Pekingesen weitergegeben werden: kurze Schnauze, kurze Beine, langer Rücken, viele Nasenfalten mit Hautinfektionen.
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” des Tierhalter-Dekrets und Artikel 2 Satz 1 des Dekrets “Zucht mit brachycephalen Hunden” verboten, Hunde zu züchten, deren Schnauze kürzer als ein Drittel der Schädellänge ist und die weitere der oben genannten damit zusammenhängende Probleme aufweisen: bei der Atmung in Ruhe ein Nebengeräusch erzeugen; mäßige bis starke Verengung der Nasenöffnungen aufweisen; eine Nasenfalte mit Haaren, die von der Nasenfalte aus die Hornhaut oder Bindehaut berühren oder berühren könnten oder die nass ist; Entzündungszeichen in einem oder beiden Augen, die mit dem Vorhandensein der Nasenfalte zusammenhängen; ein Auge mit in zwei oder mehr Quadranten sichtbarem Augenweiß; ein Augenlid, das beim Auslösen des Lidreflexes nicht vollständig geschlossen werden kann.
Ausführliche rechtliche Bewertungen und/ oder Gutachten können, soweit schon vorhanden, auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden.
10. Relevante Rechtsprechung
- Deutschland: Nicht zu Pekingesen, aber zu Brachycephalie beim French Bulldog: VG Stade, Beschluss v. 07.07. 2022, 10 B 481/22 und OVG Lüneburg, Beschluss v. 25.10.2022, 11 ME 221722
- Österreich: bisher nicht bekannt.
- Schweiz: bisher nicht bekannt.
- Niederlande: Gericht für Zivilrecht Amsterdam, Urteil vom 4.Juni 2025, Verbot der Ausstellung von Ahnentafeln für brachycephale Rassen
- Schweden: bisher nicht bekannt.
- Norwegen: bisher nicht bekannt.
11. Anordnungsbeispiel vorhanden?
Nein.
Anordnungsbeispiele werden ausschließlich auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt.
12. Zuwendungen und Förderungen
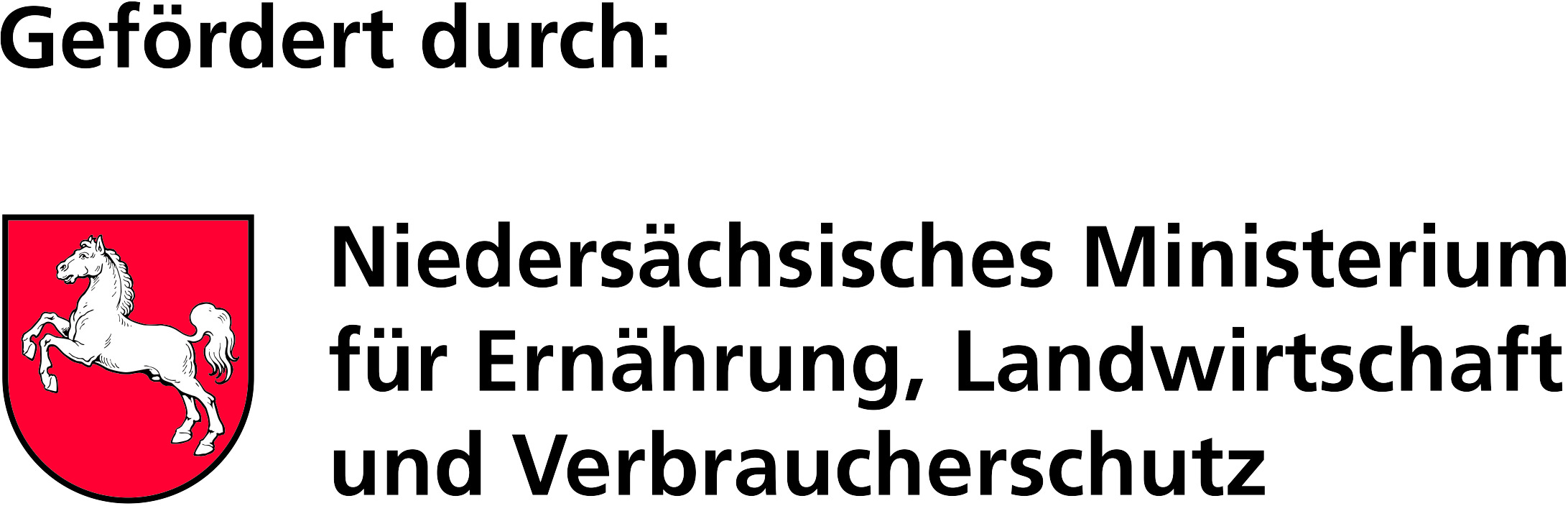
13. Literaturverzeichnis/ Referenzen/ Links
An dieser Stelle wird nur eine Auswahl an Quellen zu den oben beschriebenen Defekten und ggf. allgemeine Literatur zu zuchtbedingten Defekten bei Hunden angegeben. Umfangreichere Literaturlisten zum wissenschaftlichen Hintergrund werden auf Anfrage von Veterinärämtern ausschließlich an diese versendet.
Hinweis: Die Beschreibung von mit dem Merkmal verbundenen Gesundheitsproblemen, für die bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, erfolgen vor dem Hintergrund entsprechender Erfahrungen der Experten und Expertinnen aus der tierärztlichen Praxis, und/oder universitären Einrichtungen, sowie öffentlich frei einsehbaren Datenbanken oder Veröffentlichungen von Tier-Versicherungen und entstammen daher unterschiedlichen Evidenzklassen.
Da Zucht und Ausstellungswesen heutzutage international sind, beziehen sich die Angaben in der Regel nicht nur auf Prävalenzen von Defekten oder Merkmalen in einzelnen Verbänden, Vereinen oder Ländern.
Quellen:
AGRIA Pet Insurance Sweden. (o. J.). Pekingese Agria Breed Profiles Veterinary Care 2016-2021.
Asher, L., Diesel, G., Summers, J. F., McGreevy, P. D., & Collins, L. M. (2009). Inherited defects in pedigree dogs. Part 1: Disorders related to breed standards. The Veterinary Journal, 182(3), 402–411. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2009.08.033
Bellumori, T. P., Famula, T. R., Bannasch, D. L., Belanger, J. M., & Oberbauer, A. M. (2013). Prevalence of inherited disorders among mixed-breed and purebred dogs: 27,254 cases (1995–2010). Journal of the American Veterinary Medical Association, 242(11), 1549–1555. https://doi.org/10.2460/javma.242.11.1549
Bergström, A., Nødtvedt, A., Lagerstedt, A., & Egenvall, A. (2006). Incidence and Breed Predilection for Dystocia and Risk Factors for Cesarean Section in a Swedish Population of Insured Dogs. Veterinary Surgery, 35(8), 786–791. https://doi.org/10.1111/j.1532-950X.2006.00223.x
Brown, E. A., Dickinson, P. J., Mansour, T., Sturges, B. K., Aguilar, M., Young, A. E., Korff, C., Lind, J., Ettinger, C. L., Varon, S., Pollard, R., Brown, C. T., Raudsepp, T., & Bannasch, D. L. (2017). FGF4 retrogene on CFA12 is responsible for chondrodystrophy and intervertebral disc disease in dogs. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(43), 11476–11481. https://doi.org/10.1073/pnas.1709082114
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). (2015). Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/747/de
Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (TSchG) Österreich (2005). https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541
Chai, O., Harrosh, T., Bdolah-Avram, T., Mazaki-Tovi, M., & Shamir, M. H. (2018). Characteristics of and risk factors for intervertebral disk extrusions in Pekingese. Journal of the American Veterinary Medical Association, 252(7), 846–851. https://doi.org/10.2460/javma.252.7.846
Costa, J., Steinmetz, A., & Delgado, E. (2021). Clinical signs of brachycephalic ocular syndrome in 93 dogs. Irish Veterinary Journal, 74(1), 3. https://doi.org/10.1186/s13620-021-00183-5
Di Dona, F., Della Valle, G., & Fatone, G. (2018). Patellar luxation in dogs. Veterinary Medicine: Research and Reports, Volume 9, 23–32. https://doi.org/10.2147/VMRR.S142545
Fawcett, A., Barrs, V., Awad, M., Child, G., Brunel, L., Mooney, E., Martinez-Taboada, F., McDonald, B., & McGreevy, P. (2018). Consequences and Management of Canine Brachycephaly in Veterinary Practice: Perspectives from Australian Veterinarians and Veterinary Specialists. Animals, 9(1), 3. https://doi.org/10.3390/ani9010003
Geiger, M., Schoenebeck, J. J., Schneider, R. A., Schmidt, M. J., Fischer, M. S., & Sánchez-Villagra, M. R. (2021). Exceptional Changes in Skeletal Anatomy under Domestication: The Case of Brachycephaly. Integrative Organismal Biology, 3(1), obab023. https://doi.org/10.1093/iob/obab023
Gelatt, K. N., & MacKay, E. O. (2004). Prevalence of the breed‐related glaucomas in pure‐bred dogs in North America. Veterinary Ophthalmology, 7(2), 97–111. https://doi.org/10.1111/j.1463-5224.2004.04006.x
Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists, (ACVO). (2023). ACVO 2023 The Blue Book—Ocular disorders presumed to be inherited in purebreed dogs (15th Edition). https://ofa.org/wp-content/uploads/2024/05/ACVO-Blue-Book-2023.pdf
Hale, F. A. (2021). Dental and Oral Health for the Brachycephalic Companion Animal . In Health and Welfare of Brachycephalic (Flat-faced) Companion Animals (1., S. 235–250). Taylor and Francis Group. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429263231-14/dental-oral-health-brachycephalic-companion-animal-fraser-hale
Hirt, A., Maisack, C., Moritz, J., & Felde, B. (2023). Tierschutzgesetz: Mit TierSchHundeV, TierSchNutztV, TierSchVersV, TierSchTrV, EU-Tiertransport-VO, TierSchlV, EU-Tierschlacht-VO, TierErzHaVerbG: Kommentar (4. Auflage). Verlag Franz Vahlen.
Kim, J. Y., Won, H.-J., & Jeong, S. (2009). A Retrospective Study of Ulcerative Keratitis in 32 Dogs. 7(1).
Kluge, H.-G. (Hrsg.). (2002). Tierschutzgesetz: Kommentar (1. Aufl). Kohlhammer.
Lim, C., Kweon, O.-K., Choi, M.-C., Choi, J., & Yoon, J. (2010). Computed tomographic characteristics of acute thoracolumbar intervertebral disc disease in dogs. Journal of Veterinary Science, 11(1), 73. https://doi.org/10.4142/jvs.2010.11.1.73
Lorz, A., & Metzger, E. (2019). Tierschutzgesetz: Mit Allgemeiner Verwaltungsvorschrift, Art. 20a GG sowie zugehörigen Gesetzen, Rechtsverordnungen und Rechtsakten der Europäischen Union: Kommentar (7., neubearbeitete Auflage). C.H. Beck.
Meola, S. D. (2013). Brachycephalic Airway Syndrome. Topics in Companion Animal Medicine, 28(3), 91–96. https://doi.org/10.1053/j.tcam.2013.06.004
Nečas, A. (1999). Clinical Aspects of Surgical Treatment of Thoracolumbar Disc Disease in Dogs. A Retrospective Study of 300 Cases. Acta Veterinaria Brno, 68(2), 121–130. https://doi.org/10.2754/avb199968020121
Niederländische Grundsatzregelung für brachycephale Rassen (2023). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2023-23619.pdf
Niederländischer Staatssekretär für Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovation vom 19. Oktober 2012, Nr. 291872, Direktion für Gesetzgebung und Rechtsfragen. (2024). Niederländisches Tierhalter-Dekret. Tierhalter Dekret. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2024-07-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel3.4
Orthopedic Foundation for Animals (OFA). (o. J.). Patellar Luxation. OFA. https://ofa.org/diseases/patellar-luxation/
Packer, R. M. A., Hendricks, A., & Burn, C. C. (2015). Impact of Facial Conformation on Canine Health: Corneal Ulceration. PLOS ONE, 10(5), e0123827. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123827
Palmer, S. V., Espinheira Gomes, F., & McArt, J. A. A. (2021). Ophthalmic disorders in a referral population of seven breeds of brachycephalic dogs: 970 cases (2008–2017). Journal of the American Veterinary Medical Association, 259(11), 1318–1324. https://doi.org/10.2460/javma.20.07.0388
Schweizerischer Bundesrat. (2024). Tierschutzverordnung (TSchV) Schweiz. FedLex. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/de
Smolders, L. A., Bergknut, N., Grinwis, G. C. M., Hagman, R., Lagerstedt, A.-S., Hazewinkel, H. A. W., Tryfonidou, M. A., & Meij, B. P. (2013). Intervertebral disc degeneration in the dog. Part 2: Chondrodystrophic and non-chondrodystrophic breeds. The Veterinary Journal, 195(3), 292–299. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2012.10.011
Tolar, E. L., Hendrix, D. V. H., Rohrbach, B. W., Plummer, C. E., Brooks, D. E., & Gelatt, K. N. (2006). Evaluation of clinical characteristics and bacterial isolates in dogs with bacterial keratitis: 97 cases (1993–2003). Journal of the American Veterinary Medical Association, 228(1), 80–85. https://doi.org/10.2460/javma.228.1.80
Dieses Merkblatt wurde durch die QUEN gGmbH unter den Bedingungen der „Creative Commons – Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ – Lizenz, in Version 4.0, abgekürzt „CC BY-NC-SA 4,0“, veröffentlicht. Es darf entsprechend dieser weiterverwendet werden, Eine Kopie der Lizenz ist unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ einsehbar. Für eine von den Bedingungen abweichende Nutzung wird die Zustimmung des Rechteinhabers benötigt.
Sie können diese Seite hier in eine PDF-Datei umwandeln:



