Tierart: Hund
Rasse: Chihuahua
QUEN-Merkblatt Nr. 35
Bearbeitungsstand: 28.07.2025
Tierart: Hund
Rasse: Chihuahua
QUEN-Merkblatt Nr. 35
Bearbeitungsstand: 28.07.2025
1. Beschreibung der Tiere
FCI Rassestandard* Nr.: 218
Äußeres Erscheinungsbild und laut Standard geforderte, kritische Merkmale:
Der Chihuahua gilt als weltweit kleinste Hunderasse. Bei Chihuahuas wird nicht die Größe berücksichtigt, sondern nur das Gewicht. Es sollte zwischen 1 und 3 kg liegen, das Idealgewicht zwischen 1.5 und 2.5 kg.
Gemäß Rassestandard ist der Chihuahua ein kompakter Hund. Der Körperbau ist v.a. bei Rüden fast quadratisch, bei Hündinnen aufgrund ihrer reproduktiven Funktion etwas länger. Der kleine Schädel ist rund und apfelförmig. Der Fang ist kurz und hält im Profil eine gerade Linie. Die Augen sind groß und rund.
*Rassestandards und Zuchtordnungen haben im Gegensatz zu TierSchG und TierSchHuV keine rechtliche Bindungswirkung.
2.1 Bild 1

Chihuahua (Kurzhaar).
Foto: QUEN-Archiv.
2.1 Bild 2

Chihuahua (Kurzhaar).
Foto: QUEN-Archiv.
Weitere Fotos finden Sie hier (Bild anklicken):
3. In der Rasse häufig vorkommende Probleme/Syndrome
Von mehreren in dieser Rasse vorkommenden Problemen und möglicherweise auftretenden Erkrankungen werden an dieser Stelle nur die wichtigsten rassetypischen Defekte aufgeführt.
Beim Chihuahua sind folgende rassetypische Defekte oder gehäuft vorkommende Probleme/ Gesundheitsstörungen und Dispositionen* bekannt:
* (bitte dazu auch die bereits vorhandenen Merkblätter zu einzelnen Defekten wie insbesondere Brachycephalie, Color Dilution Alopecia (CDA) und Merkblatt Nr. 34 Hund Rasse Cavalier King Charles Spaniel (zu CM/SM) beachten).
- Patellaluxation
- Mitralklappenerkrankungen
- Chiari-ähnliche Malformation/Syringomyelie
- Augenerkrankungen
- Brachycephalie
- BOAS (Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom)
- Hydrocephalus
- Hauterkrankungen
4. Weitere ggf. gehäuft auftretende Probleme
In der veterinärmedizinischen Fachliteratur finden sich neben den unter Punkt 3 angegebenen rassetypischen Defekten Hinweise zum Vorkommen folgender Probleme, die nachfolgend nicht weiter ausgeführt werden, da noch keine abschließenden Schlussfolgerungen aus den bekannt gewordenen Prävalenzen gezogen werden können und durch Züchter, Zuchtvereine und -verbände keine unter wissenschaftlichen Kautelen erhobenen Prävalenzen angegeben werden. Für diese Fälle ist jedoch die folgende Aussage von Hale (2021) zutreffend: “The absence of evidence is not the evidence of absence”.
- Atlantoaxiale Subluxation/Instabilität
- Bandscheibenerkrankungen (IVDD)
- Chondrodysplasie
- Dystokie
- Eklampsie/puerperale Tetanie
- Epilepsie
- Extrahepatischer portosystemischer Shunt
- Gallenblasenmukozele
- Hämophilie
- Keratokonjunctivitis sicca
- Kryptorchismus
- Legg-Calvè-Perthes Erkrankung
- Nekrotisierende Meningoenzephalitis
- Neuroaxonale Dystrophie
- Neuronalen Ceroid-Lipofuszinosen (NCL)
- Parodontalerkrankungen
- Persistierender Ductus arteriosus (PDA)
- Persistierende Fontanellen
- Pulmonalstenose
- Schablonenkrankheit (pattern baldness)
- Trachealkollaps
- Urolithiasis
5. Symptomatik und Krankheitswert einiger Defekte: Bedeutung/Auswirkungen des Defektes auf das physische/ psychische Wohlbefinden (Belastung) des Einzeltieres u. Einordnung in Belastungskategorie∗
*Die einzelnen zuchtbedingten Defekte werden je nach Ausprägungsgrad unterschiedlichen Belastungskategorien (BK) zugeordnet. Die Gesamt-Belastungskategorie richtet sich dabei nach dem jeweils schwersten am Einzeltier festgestellten Defekt. Das hier verwendete BK-System als Weiterentwicklung nach dem Vorbild der Schweiz (das bedeutet, die Beurteilung kann von der Einteilung in der Schweiz abweichen) ist noch im Aufbau und ist das Ergebnis tierschutzfachlicher Beurteilung. Daher sind die hier vorgenommenen BK-Werte als vorläufig anzusehen und bieten bis zu einer angestrebten länderübergreifenden Definition eine Unterstützung zur ersten Orientierung. So werden z.B. Funktionseinschränkungen von Sinnesorganen je nach Ausprägung der Belastungskategorie 2-3 zugeordnet.
In der Schweiz werden die Belastungen, die durch Zuchtmerkmale entstehen können, in 4 Kategorien eingeteilt (Art. 3 TSchZV, Schweiz). Für die Zuordnung eines Tieres zu einer Belastungskategorie ist das am stärksten belastende Merkmal oder Symptom entscheidend (Art. 4 TSchZV, Schweiz).
Kategorie 0 (keine Belastung): Mit diesen Tieren darf gezüchtet werden.
Kategorie 1 (leichte Belastung): Eine leichte Belastung liegt vor, wenn eine belastende Ausprägung von Merkmalen und Symptomen bei Heim- und Nutztieren durch geeignete Pflege, Haltung oder Fütterung, ohne Eingriffe am Tier und ohne regelmäßige medizinische Pflegemaßnahmen kompensiert werden kann.
Kategorie 2 (mittlere Belastung): Mit diesen Tieren darf ggf. nur gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt.
Kategorie 3 (starke Belastung): Mit diesen Tieren darf nicht gezüchtet werden.
Anmerkung vorab zu den bei dieser Rasse möglicherweise festgestellten zuchtbedingten Defekten: Zucht- und Ausstellungswesen sind heute international. Da keine belastbaren Prävalenzen zu Defektmerkmalen durch Züchter, Zuchtvereine und -verbände vorgelegt werden, wird die verfügbare internationale wissenschaftliche Literatur ausgewertet.
Patellaluxation
Physisch:
Chihuahuas haben ein erhöhtes Risiko für Patellaluxationen, die fast ausschließlich medial auftreten. Je nach Studie war das Risiko für die
Erkrankung für den Chihuahua 2,8- bis 8,9-fach erhöht. Eine Studie an 7.024 Chihuahuas ergab eine Prävalenz der Patellaluxation von 23 %. Studienergebnissen zufolge sind weibliche Chihuahuas häufiger betroffen als männliche.
Im Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA wurde für den Zeitraum von 2016 bis 2021 festgestellt, dass Chihuahuas ein fast 4-fach erhöhtes relatives Risiko für die Entwicklung von Patellaluxationen aufweisen verglichen mit dem Durchschnitt aller anderen Hunderassen. Laut dem Chihuahua Breed Summary Report der Orthopedic Foundation for Animals (OFA), lag im Jahr 2024 bei 6,2% der Tiere eine Patellaluxation vor.
In verschiedenen Veröffentlichungen wird die Patellaluxation als häufiges Kniegelenksproblem vor allem bei kleinen Hunderassen benannt. Die Patellaluxation wird als eine sogenannte Entwicklungskrankheit beschrieben, die nicht bereits bei der Geburt vorliegt, sondern sich erst im Verlauf der frühen Lebensjahre manifestiert. Dies deutet darauf hin, dass die Entstehung der Erkrankung nicht auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen ist, sondern vielmehr durch ein komplexes Zusammenspiel von genetischen (erblichen) Prädispositionen und umweltbedingten Einflüssen bedingt wird. Umweltfaktoren können dabei beispielsweise biomechanische Belastungen, Wachstumsbedingungen oder Fehlhaltungen umfassen, während erbliche Faktoren genetische Veranlagungen für eine instabile Patella oder anatomische Besonderheiten betreffen. Die Kombination dieser Aspekte führt letztlich zur Entwicklung der Patellaluxation im jungen Alter. Die Heritabilität für Patellaluxation liegt bei 0,24-0,25, eine Studie aus Finnland gibt einen Wert von 0,22 an. Bei der Patellaluxation wird die Kniescheibe aus ihrer normalen Position im Sulcus trochlearis des Oberschenkelknochens nach medial oder lateral verlagert. Dies geschieht vor allem während der Fortbewegung. Verschiedene Autor*innen beschreiben, dass sich die klinischen Symptome von Hund zu Hund sehr unterscheiden können. Die Patellaluxation bei Hunden wird in vier Schweregrade eingestuft. Bei Vorliegen von Grad 1 sind die Tiere meist asymptomatisch. Bei Grad 2 zeigen die Hunde ein charakteristisches Hüpfen (Lahmheit, vor allem intermittierend) und zeitweise einen Gang auf drei Beinen. Mit zunehmendem Schweregrad nehmen auch die Symptome zu, wie z.B. Lahmheiten der belasteten Seite mit gelegentlichen Anheben der Gliedmaße und Schmerzen. Typischerweise strecken die betroffenen Hunde die Gliedmaße nach hinten, damit die Patella reluxieren kann. Sowohl uni- als auch bilaterale Patellaluxationen haben einen Einfluss auf die Bewegung der Vorder- und Hintergliedmaßen. Im Schritt und Trab kann beobachtet werden, dass der Bewegungsspielraum im Hüft- und Tarsalgelenk eingeschränkt ist.
Psychisch:
Die Hunde leiden an Lahmheiten, später auch unter Osteoarthritis und Schmerzen, die viele Verhaltensweisen negativ beeinflussen und somit ihr Wohlbefinden beeinträchtigen können.
Belastungskategorie: 2
Mitralklappenerkrankungen
Physisch:
Für Chihuahuas besteht eine Prädisposition für Mitralklappenerkrankungen. Je nach Studie liegt die Prävalenz für die Erkrankung zwischen 2,2 % und 2,5 %. Es wurde festgestellt, dass reinrassige Hunde mit degenerativer Mitralklappeninsuffizienz im Vergleich zu Mischlingshunden ein um das 1,86-fache erhöhtes Sterberisiko aufweisen. Die Ergebnisse der Studie lassen annehmen, dass Chihuahuas anfälliger für schwerwiegende Folgen der Erkrankung sein könnten und daher eine intensivere medizinische Betreuung benötigen.
Bei der degenerativen Mitralklappenerkrankung kommt es zu einer Mitralklappeninsuffizienz, bei der die Klappe zwischen linkem Vorhof und linker Kammer schließt nicht mehr richtig schließt. Dadurch wird das vorwärtsgerichtete Schlagvolumen beeinträchtigt, und das Herz wird linksseitig durch eine Volumenüberlastung beeinträchtigt. Dies führt schließlich zur Aktivierung von Kompensationsmechanismen. Zu Beginn treten die klinischen Anzeichen nur unter kardialer Belastung auf und die Hunde entwickeln im klinischen Verlauf einen Husten. Mit dem Fortschreiten der Krankheit verändern sich allmählich Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität und die Tiere können Atemnot und Synkopen (kurze Ohnmachtsanfälle) entwickeln.
Psychisch:
Eine Beeinträchtigung der Belastungsfähigkeit schränkt die Hunde in ihrem arttypischen Verhalten ein. Die Atemnot bei Anstrengung kann zudem Angst auslösen, weil die Hunde diese Situation als lebensbedrohlich empfinden. Diese Angstzustände werden als Leiden betrachtet, da sie das Wohlbefinden der Tiere erheblich beeinträchtigen.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägungsgrad
Chiari-ähnliche Malformation/Syringomyelie (s. auch Merkblatt Nr. 34 Hund Rasse Cavalier King Charles Spaniel)
Physisch:
Die Chiari-ähnliche Malformation tritt gehäuft bei kleinen Rassen, wie dem Chihuahua auf. Chihuahuas sind auch von Syringomyelie betroffen. Im Vergleich zu Mischlingshunden hat der Chihuahua ein 7,4-fach erhöhtes Risiko an Chiari-ähnlicher Malformation und Syringomyelie zu erkranken. Die auch für den Chihuahua typischen Veränderungen des Schädels und der darin befindlichen Strukturen stehen im Zusammenhang mit der Entstehung einer Chiari-ähnlichen Malformation und Syringomyelie. Rusbridge et al. (2018) beschreiben die knöchernen und parenchymalen Veränderungen, die unter dem Begriff der Chiari-ähnlichen Malformation zusammengefasst werden können. Es wird davon ausgegangen, dass es zu einem vorzeitigen Schluss der Schädelsuturen kommt, der zu einer Verengung im rostrotentorialen Bereich führt (das Tentorium ist eine durale Falte, die das Kleinhirn vom Großhirn trennt), was eine Herniation des Hinterhirns verursachen kann. Zusätzlich wird die Situation kompliziert durch eine Deformation der Verbindung zwischen Schädel und Halswirbelsäule, einschließlich Veränderungen bei der Ausrichtung des Dens Axis, einer verringerten Distanz zwischen Atlas und Schädel sowie einem Verlust der Cisterna magna, einem wichtigen Liquorraum. Es kommt zur Kompression des Gehirns und Rückenmarks und häufig zu daraus resultierenden Herniationen des Metenzephalons. Bei einigen betroffenen Tieren liegt hingegen eine Vertiefung des Kleinhirns (cerebellar indentation) mit Verlagerung des Kleinhirns vor.
Hunde mit einer Chiari-ähnlichen Malformation und Syringomyelie können anhaltende Kratzepsioden der Ohren, Schultern oder vorderen Brustwirbelsäule mit und ohne Hautkontakt (Phantomkratzen), Gesichtsreiben, Wirbelsäulenschmerzen, Hyperästhesie im zervikalen und kranialen Bereich, Vokalisation, Gangabweichungen wie fehlende Koordination oder Schwäche zeigen. Weitere neurologische Symptome sind möglich. Die Hunde können auch Anzeichen für neuropathische Schmerzen zeigen. Die Hunde sind mitunter weniger aktiv und ihre Schlafphasen sind unterbrochen. Ähnliche Symptome treten bei der Chiari-ähnlichen Malformation auch ohne Syringomyelie auf und weisen auf die Bedeutung von Anomalien des kraniozervikalen Übergangs hin. Diese Anomalien können aber dennoch ein Risikofaktor für Syringomyelien sein. Anhand erfolgter Untersuchungen schließt Rusbridge (2020) darauf, dass erste Symptome einer Chiari-ähnlichen Malformation meist in den ersten Lebensjahren auftreten.
Eine häufige Folge der Chiari-ähnlichen Malformation ist eine Syringohydromyelie/Syringomyelie. Bei der Syringomyelie treten mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume im Rückenmark auf, die Druck auf das Rückenmark ausüben können. Die genauen Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Es wird unter anderem vermutet, dass es an einem beeinträchtigten Fluss der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (CSF) liegt. Häufig tritt eine Syringomyelie erst im späteren Alter auf und meist sind die Tiere nicht jünger als fünf Jahre. Syringomyelie ist ein prädisponierender Faktor für das Vorhandensein von neuropathischem Schmerz.
Bei Chihuahuas mit klinischen Symptomen einer Syringomyelie/Chiari-ähnliche Malformation konnten gehäuft persistierende Fontanellen festgestellt werden. Es wird von einer Assoziation beider Auffälligkeiten ausgegangen.
Psychisch:
Betroffene Hunde sind in ihrem Verhalten und Wohlbefinden durch die motorischen Einschränkungen und neurologischen Defizite eingeschränkt. Schmerzen wirken sich ebenfalls negativ auf die Tiere aus. Angst und Furcht, die durch neuropathische Schmerzen begünstigt werden können, schränken die Lebensqualität stark ein. Selbst Berührungen und Anheben können, weil schmerzhaft, bereits Vokalisationen (Jaulen) verursachen. Reduzierte Aktivität und beeinträchtigtes bzw. unterbrochenes Schlafen führen zu Leiden.
Belastungskategorie: 3
Augenerkrankungen
Physisch:
In einer retrospektiven Studie an einer nordamerikanischen Universitätsklinik wiesen Chihuahuas im Vergleich zu Mischlingshunden mit 1,84 % eine erhöhte Prävalenz für primären Katarakt auf. Die Katarakthäufigkeit war in der Gruppe der 10- bis 15-jährigen Chihuahuas besonders hoch. Insgesamt sank die Prävalenz für Katarakt jedoch innerhalb der letzten 10 Jahre der Datenerhebung. Auch das Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists führt beim Chihuahua eine Prävalenz für Katarakt von 2,1 % an. In einer retrospektiven Studie war das Risiko für Chihuahuas an einer Katarakt zu erkranken gegenüber der Referenzpopulation 1,3-fach erhöht.
Weiter zählt der Chihuahua zu den am häufigsten von ulcerativen Keratitis betroffenen Hunderassen. Es wird vermutet, dass Unterschiede in der Lidspaltenbreite und der Schädelform bei diesen Hunden möglicherweise Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer Augenoberfläche haben könnten. Diese Auswirkungen könnten sich durch Veränderungen in der Blinzelrate, die Reibung der Augenoberfläche, die Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit oder durch leichte pathologische Veränderungen der Hornhaut zeigen. Solche Faktoren könnten also das Risiko für Augenprobleme erhöhen oder die Augenoberfläche beeinträchtigen. Die Erkrankung kann zum Verlust des Augapfels führen.
Genotypisierungen geben Hinweise auf die genetischen Faktoren, die zur Entstehung der progressiven Retinaatrophie beim Chihuahua beteiligt sind. Häufig tritt die späte Form der PRA beim Chihuahua auf, da bei den meisten betroffenen Hunden die Krankheit klinisch erst im Alter von 3 bis 6 Jahren oder älter erkannt wird. Nach Angaben des Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists (ACVO) handelt es sich bei der progressiven Retinaatrophie (PRA) um eine degenerative Erkrankung der Sehzellen der Netzhaut, die bis zur Erblindung fortschreitet. Die PRA umfasst eine Gruppe von Erkrankungen mit ähnlichem klinischen Erscheinungsbild und wird in verschiedene Formen unterteilt, die auf dem Alter beim Auftreten, den pathologischen Merkmalen und genetischen Mutationen in bestimmten Genen beruhen. Die progressive Stäbchen-Zapfen-Degeneration (PRCD) ist eine Form davon. Sie tritt meist im mittleren bis höheren Lebensalter auf und verursacht eine Degeneration der Photorezeptoren. Die Degeneration der normal entwickelten Photorezeptoren ist durch ein langsames Absterben der Sehzellen gekennzeichnet. Die ersten klinischen Anzeichen sind Nachtblindheit, im weiteren Verlauf gefolgt von Tagblindheit.
Die Hornhautdystrophie des Chihuahuas wird als eine primäre Endothelerkrankung, die zu einem fortschreitenden und dauerhaften Hornhautödem führt, beschrieben. Chihuahuas gehören zu den Rassen, die bei dieser Erkrankung überrepräsentiert sind. Die Erkrankung tritt bei älteren Hunden auf, meist im Alter zwischen 6 und 13 Jahren, mit einem Durchschnittsalter von etwa 9,5 Jahren. Das Hornhautödem beginnt zunächst ohne sichtbare Symptome im dorsalen, temporalen Bereich der Hornhaut eines Auges und breitet sich langsam nach innen aus, bis schließlich die gesamte Hornhaut betroffen ist. In der Regel ist die Erkrankung beidseitig ausgeprägt.
Psychisch:
Augenerkrankungen können bei den Tieren Schmerzen verursachen und je nach Schweregrad die Sehfähigkeit beeinträchtigen. Ulcerative Veränderungen der Cornea haben starken Einfluss auf das Wohlbefinden der Tiere, da sie zu Schmerzen, einer Uveitis, Perforation bis hin zur Beeinträchtigung des Sehvermögens und zum Verlust des Auges führen können. Hunde mit stark eingeschränktem Sehvermögen oder Blindheit sind kaum in der Lage, Körpersignale wie Haltung, Schwanzhaltung oder Augen-, Kopf- und Maulzeichen zu erkennen oder selbst zu verwenden. Dies kann zu Verhaltensänderungen, Ängstlichkeit und Unsicherheit führen.
Belastungskategorie: 2-3
Brachycephalie (s. auch Merkblatt Nr. 8 Hund Brachycephalie und weitere Merkblätter brachycephaler Rassen)
Physisch:
Die zuchtbedingten Veränderungen des Schädels, die mit der Brachycephalie einhergehen, fassen Geiger et al. (2021) in ihrer ausführlichen Übersicht zusammen. Charakteristisch ist der kurze und runde Schädel mit einer flachen Schnauze und kurzer Nase. Während bei einigen Hunderassen neben den verkürzten Knochen auch eine aufgebogene Schnauze auftritt, ist eine solche Airorhynchie bei Rassen wie dem Chihuahua nicht vorhanden, da der Winkel zwischen Schädelbasis und Gaumen im Schnitt weniger als 180° beträgt. In einer Studie aus Großbritannien zählte der Chihuahua innerhalb der untersuchten Population mit 22,91 % zu den häufigsten brachycephalen Rassen. Der Gesundheitszustand von brachycephalen Hunderassen ist im Vergleich zu nicht-brachycephalen Rassen eingeschränkt. Brachycephale Hunde erkranken häufiger und weisen ein höheres Risiko für verschiedene Erkrankungen auf [81]. Die Lebenserwartung von brachycephalen Rassen ist im Vergleich zu meso- und dolichocephalen Hunden reduziert. Als Gründe dafür werden die mit der Brachycephalie assoziierten Prädispositionen, wie BOAS, Wirbelsäulenerkrankungen und weitere Auffälligkeiten vermutet.
Psychisch:
Im Vergleich zu Rassen ohne extreme Schädelform scheinen brachycephale Rassen deutlich häufiger von verschiedenen Erkrankungen betroffen zu sein und eine geringere Lebenserwartung zu haben. Viele Verhaltensweisen und Lebensbereiche der Tiere werden durch die Brachycephalie und daraus folgenden Erkrankungen negativ beeinflusst. Es kann bei der Futteraufnahme zu Atemnot und damit zu Angstzuständen kommen. Betroffene Tiere benötigen meist nach aktiven Phasen eine längere Erholungsphase. Das Spielen mit Artgenossen kann eingeschränkt sein. Insgesamt kann daher davon ausgegangen werden, dass die Lebensqualität deutlich vermindert ist.
Belastungskategorie: 3
BOAS (Brachycephales Obstruktives Atemwegssyndrom)
(s. auch weitere Merkblätter brachycephaler Rassen)
Physisch:
Übersichtsarbeiten wie von Meola (2013) beschreiben die anatomischen und physiologischen Grundlagen des Brachycephalen Obstruktiven Atemwegssyndroms (BOAS) und deren Folgeerscheinungen. Zu den primären Komponenten gehören kongenitale anatomische Merkmale wie z.B. stenotische Nasenlöcher, ein verlängerter weicher Gaumen, eine hypoplastische Luftröhre und nasopharyngeale Turbinate. Erhöhte Turbulenzen und ein erhöhter Atemwiderstand können zur Entwicklung sekundärer Veränderungen führen. Dazu gehören Gaumen- und Kehlkopfödeme, Schwellungen, ausgestülpte Saccula und Tonsillen sowie ein Kehlkopfkollaps, die alle zu einer lebensbedrohlichen Beeinträchtigung der Atmung führen können.
Ein begünstigender Faktor für das BOAS ist die Brachycephalie. Brachycephale Hunde weisen durch den verkürzten Schädel ein relativ verlängertes Gaumensegel im Vergleich zu nicht-brachycephalen Hunden auf. Zudem ist das Gaumensegel verdickt. Der Raum bzw. das Volumen des Nasopharynx ist hingegen signifikant verkleinert. Das Risiko für BOAS sinkt mit zunehmender relativer Schnauzenlänge. Bei kleinerem kraniofazialen Verhältnis (Division der Schnauzenlänge durch die Schädellänge), wie es bei brachycephalen Rassen üblich ist, steigt im Vergleich zu Rassen mit anderen Schädelformen das Risiko für BOAS. Weitere Risikofaktoren für eine Entstehung oder Verschlechterung können Halsumfang, Übergewicht und eine erfolgte Kastration sein. Chirurgische Korrekturen der anatomischen Veränderungen können indiziert sein.
Betroffene Hunde zeigen neben typischen Schnarchgeräuschen, Belastungsintoleranz, Dyspnoe, Würgen, Regurgitieren, Erbrechen, Stridor und Synkopen. Hinzu kommt eine gestörte Thermoregulation.
Anmerkung: Entgegen der verbreiteten Überzeugung, dass eine nur mäßige Einschränkung der Atemfunktion (z.B. Cambridge-Test Ergebnis Grad 1) für das Tier eine Zucht- oder Ausstellungseignung begründen würde, ist diese Einschätzung aus medizinischer Sicht nicht nachvollziehbar, da es sich um einen durch anatomische Veränderung verursachten pathologischen Befund, mit einem in der Regel progressiven Verlauf handelt.
Psychisch:
Verschiedene operative Eingriffe können beim BOAS indiziert sein und dienen dazu, die Atemwegsobstruktionen zu beheben und die Lebensqualität der Hunde zu verbessern. Vor allem die postoperative (Aufwach-)Phase ist besonders riskant und benötigt intensive Beobachtung und Pflege. Die Auswertung verschiedener Studien zeigte, dass eine vollständige Behebung der Probleme jedoch nicht immer erreichbar ist. Die oben aufgeführten klinischen Symptome beeinträchtigen das arttypische Verhalten und Wohlbefinden der Tiere lebenslang erheblich.
Belastungskategorie: 3
Hydrocephalus
Physisch:
Verschiedene Publikationen beschreiben ein gehäuftes Auftreten von kongenitalem Hydrocephalus bei Chihuahuas. Betroffene Tiere können eine veränderte Schädelform oder eine offene Fontanelle aufweisen. Die Tiere können neurologische Defizite zeigen, sowie Veränderungen des mentalen Zustandes in Form von depressiven Zuständen bis Übererregbarkeit. Das Bewusstsein oder die Funktion von Sinnesorganen (Sehen und Hören) kann eingeschränkt sein. Betroffene Hunde bewegen sich unkoordiniert, kreisen und können zentralnervöse Erscheinungen (Anfälle) zeigen. Dilatierte und starre Pupillen, Blindheit und Strabismus sind ebenfalls möglich. Die Symptome können sich im zunehmenden Verlauf verschlechtern. Manche Tiere zeigen keine klinischen Erscheinungen.
Ein angeborener Hydrocephalus tritt auch als Folge einer Vielzahl von Anomalien des Nervensystems auf, darunter auch Chiari-ähnliche Malformation (siehe dort).
Psychisch:
Aufgrund der sehr variierenden Klinik sind die Auswirkungen für die Tiere sehr unterschiedlich und richten sich nach der jeweiligen Symptomatik. Das können belastende, übererregte oder depressive Zustände sein sowie Einschränkungen in der Beweglichkeit, die wiederum Auswirkungen auf das Verhalten haben können.
Belastungskategorie: 3
Hauterkrankungen (s. auch Merkblatt Nr. 25 Hund Color Dilution Alopecia)
Physisch:
Hobi et al. (2023) beschreiben in einer Übersichtsarbeit, dass Melaninvorläufer mit zytotoxischen Eigenschaften und abnormen Pigmentklumpen in der Epidermis, dem Haarschaft, dem Haarfollikel und der Haarmatrix, zu einer Ausbeulung und einem Bruch der Haarkutikula führen, was letztendlich zur Alopezie führen kann. Für die beschriebene Color Dilution Alopecia (CDA, dt. Farbverdünnungshaarausfall) sind Chihuahuas prädisponiert. An den betroffenen Stellen kommt es zu fortschreitender Hypertrichose, Alopezie und Schuppenbildung, außerdem zu Follikulitis und Furunkulose. Es ist keine spezifische Behandlung für die Color Dilution Alopecia bekannt. Betroffene Hunde dürfen keiner intensiven UV-Licht-Exposition ausgesetzt werden. Zudem muss besonders darauf geachtet werden, dass betroffene Hunde keine Hautverletzungen erleiden.
Psychisch:
Bei der Color Dilution Alopecia leiden die Hunde aufgrund der oben beschriebenen schmerzhaften Sekundärinfektionen sowie aufgrund Frierens bei kalten Temperaturen, wovor ein der Tierart entsprechendes Haarkleid Hunde normalerweise schützt.
Belastungskategorie: 2
Lebenserwartung und Mortalität
Die Lebenserwartung von brachycephalen Rassen ist im Vergleich zu meso- und dolichocephalen Rassen kürzer. Gründe dafür sind Erkrankungen wie BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome), Wirbelsäulenerkrankungen und andere Auffälligkeiten, die bei brachycephalen Hunderassen gehäuft auftreten. Obwohl kleine Hunderassen in der Regel eine längere Lebenserwartung haben als große Rassen, liegt die mittlere Lebenserwartung des Chihuahua bei nur ca. 7-8 Jahren. Daten der AGRIA Versicherung aus den Jahren 2016 bis 2021 zeigen, dass Chihuahuas aufgrund von Herzerkrankungen und neurologischen Symptomen verstarben oder euthanasiert werden mussten. Das durchschnittliche Alter dieser Hunde zum Zeitpunkt des Todes lag bei etwa 8 Jahren. Eine nordamerikanische Studie dokumentierte über einen Zeitraum von 20 Jahren die häufigsten Todesursachen bei verschiedenen Hunderassen. Dabei gehörte der Chihuahua zu den 5 Rassen mit dem höchsten relativen Anteil an kardiovaskulären Todesursachen. Eine weitere retrospektive epidemiologische Auswertung Daten von Chihuahuas in Großbritannien stellte fest, dass bei 18,8 % der verstorbenen Tiere eine Herzerkrankung die zugrunde liegende und damit die häufigste Todesursache war.
Verhaltensprobleme durch Kleinwuchs bei „Toy-Rassen“
Aufgrund ihrer geringen Größe sind kleine Hunde sehr empfindlich. Nach einem leichten Sturz oder Sprung, durch Treten oder Draufsitzen oder sogar durch das Spielen mit Artgenossen können Frakturen auftreten. Um sie zu schützen, sind sie oft in Taschen oder Kinderwagen untergebracht. Kleine Hunde reagieren bei Gegenreaktionen häufiger aggressiv, was wiederum größere Hunde provozieren kann – mit den damit verbundenen Risiken. Wenn ein großer Hund zubeißt, kann der kleine Hund schwer verletzt werden oder sogar sterben. Es ist jedoch unklar, ob dieses Verhalten auf genetische Faktoren, erlerntes Verhalten oder eine Kombination aus beidem zurückzuführen ist. Manche Besitzer tolerieren unterschiedliche Verhaltensweisen bei kleinen und großen Hunden. Zum Beispiel wird aggressives oder anspringendes Verhalten bei einem großen Hund meist unterbunden, während dasselbe Verhalten bei einem kleinen Hund oft als niedlich empfunden und gefördert wird. Kleine Hunde werden häufig getragen statt zu laufen, reagieren möglicherweise nicht auf Befehle und werden übermäßig beschützt, was ihre Entwicklung beeinträchtigen kann. Zudem könnten genetische Faktoren eine Rolle spielen. Leichtere Hunde werden oft als aufgeregt, hyperaktiv und energiegeladen beschrieben. Verhaltensweisen wie Urinieren beim Alleinlassen, Trennungsprobleme, Anhänglichkeit oder Betteln treten bei kleineren Rassen häufiger auf und könnten kindliche Verhaltensweisen oder Ausdruck von Pflegebedürftigkeit sein.
Tierethische Bewertung der Qualzuchtproblematik beim Chihuahua
Auf Basis der im vorliegenden Merkblatt genannten Fakten, welche die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von zuchtbedingten Defekten der Belastungskategorien 2-3 (mittlere bis starke Belastung) bzw. 3 (starke Belastung) auflisten, ist aus tierethischer Sicht festzustellen, dass die Weiterzucht mit von diesen Defekten betroffenen Tieren dieser Rasse als höchst problematisch einzustufen ist, da ein Züchter davon ausgehen muss, dass Tiere, die er durch seine Zucht in die Welt setzt, erheblich und andauernd Einschränkungen des Wohlbefindens, Schmerzen ertragen müssen oder leiden werden. Dies ist bereits dann inakzeptabel, wenn zumindest einer der im gegenständlichen Merkblatt genannten zuchtbedingten Defekte in den Belastungskategorien 2-3 bei mindestens einem der von ihm gezüchteten Tiere in vorhersehbarer Weise eintritt, wobei „vorhersehbar“ erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann vorliegen, wenn sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen erwartbar auftreten.
Fazit: Toy-Rassen, wie der Chihuahua, können aus den oben genannten Gründen oft das arteigene Verhaltensrepertoire nicht ausleben.
6. Vererbung, Genetik, ggf. bekannte Gen-Teste, ggf. durchschnittlicher genomischer Inzuchtkoeffizient (COI) für die Rasse
Patellaluxation
Zwei genetische Varianten (SNPs) im Inneren des DAG1-Gens auf Chromosom 20 sind stark mit der Patellaluxation bei Chihuahuas assoziiert: SNP1UBC811 und SNP2UBC811.
Mitralklappenerkrankung
Die genauen genetischen Hintergründe der Erkrankung sind noch nicht vollständig geklärt. Bisher wurden verschiedene Gene und microRNA`s entdeckt, deren Expression sich bei gesunden und erkrankten Hunden unterscheidet und somit eine Rolle spielen könnten.
Brachycephalie
Das verantwortliche Gen bzw. die verantwortlichen Gene sind nicht vollständig geklärt. Aufgrund der genetischen Komplexität wird angenommen, dass verschiedene Chromosomen einen Einfluss haben. Es besteht eine starke Assoziation zum CFA1-Gen.
Hydrocephalus
Der Chihuahua ist eine der am häufigsten betroffenen Rassen, weshalb genetische Faktoren bei der Entstehung von Hydrocephalus vermutet werden. Nicht eindeutig ist, ob die höhere Prävalenz des Hydrocephalus durch eine genetische Anomalie bedingt ist, die das zentrale Nervensystem direkt betrifft oder eher mit der abnormen Kopfmorphologie zusammenhängt.
Hauterkrankungen (Color Dilution Alopecia (CDA)
Dilution wird durch unterschiedliche genetische Varianten (Allel d1, d2 und/oder d3 sowie wahrscheinlich noch weitere, bislang nicht molekulargenetisch identifizierte Varianten) im Gen MLPH verursacht und folgt einem autosomal-rezessiven Erbgang. Die ursächliche Variante der CDA hingegen ist noch nicht molekulargenetisch identifiziert. Somit kann ein dilute Hund ohne CDA nicht per Gentest von einem dilute Hund mit CDA unterschieden werden. Betroffene Hunde sollten nicht zur Zucht verwendet werden.
Weitere für die Rasse verfügbare Gentests
Chondrodysplasie und Dystrophie
Degenerative Myelopathie (DM) Exon 2
Hyperurikosurie
Lafora-Epilepsie
Makrothrombozytopenie
Maligne Hyperthermie
Neuronale Ceroid Lipofuszinose (NCL)
Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA)
Grundlage einer verantwortungsvollen Zucht ist bei der sorgfältigen Diagnose des Einzeltieres nicht nur die Beurteilung des Exterieurs und der Verhaltenseigenschaften der Zuchtpartner vor dem ersten Zuchteinsatz, sondern auch die Nutzung moderner molekulargenetischer Diagnostik. Innerhalb eines Screenings sollte diese nicht nur zur Identifizierung von Merkmals- oder Anlageträgern, sondern auch zur Bestimmung des Inzuchtgrades des Einzeltieres genutzt werden. Inzwischen bieten Labore sogenannte „Matching Tools” oder „Mating Scores“ an, welche Züchter nutzen können, um geeignete Zuchtpartner zu identifizieren, wobei gleichzeitig die Verpaarung von Tieren mit gleichen risikobehafteten Anlagen verhindert werden kann. Verschiedene spezialisierte Labore bieten für Züchter entsprechende Beratungen an.
7. Diagnose-notwendige Untersuchungen vor Zucht oder Ausstellungen
Achtung: Invasive, das Tier belastende Untersuchungen sollten nur in begründeten Verdachtsfällen bei Zuchttieren durchgeführt werden und nicht, wenn bereits sichtbare Defekte zum Zucht- und Ausstellungsverbot führen.
Patellaluxation
Klinische und radiologische Untersuchungen sind für die Diagnostik und Einschätzung des Grades der Luxation geeignet. In der orthopädischen Untersuchung wird der Gang evaluiert und der Bewegungsradius sowie die Patella beurteilt [48]. Mithilfe von Messungen können die morphologischen Abweichungen zusätzlich eingeschätzt und verglichen werden.
Mitralklappenerkrankung
Bei einer klinischen Untersuchung kann bereits in frühen Stadien einer Mitralklappenerkrankung das Vorhandensein eines charakteristischen Herzgeräusches durch Auskultation festgestellt werden. Neben dem Überprüfen von klinischen Anzeichen können echokardiographische Untersuchungen und Röntgenbilder der Diagnose dienen. Mithilfe der Speckle-Tracking-Echokardiographie (STE) können Parameter gemessen, die Hinweise liefern, ob eine vorhandene Mitralklappeninsuffizienz fortschreitet und das Herz überlastet wird.
Chiari-ähnliche Malformation/Syringomyelie
Zur Diagnostik wird eine ausführliche Anamnese aufgenommen und eine klinische und neurologische Untersuchung vorgenommen. Zum Ausschluss anderer Ursachen beispielsweise des Kratzens und der Gangabweichungen werden dermatologische und orthopädische Untersuchungen durchgeführt. Genauere Beurteilungen sind mithilfe von bildgebenden Verfahren, wie MRT oder CT möglich.
Augenerkrankungen
Bei Verdacht auf eine Augenerkrankung wird eine vollständige ophthalmologische Untersuchung durchgeführt. Je nach Verdachtsdiagnose können ein Schirmer Tränentest, eine Tonometrie, Ophthalmoskopie sowie weitere diagnostische Verfahren Aufschluss geben.
Das Vorhandensein eines Hornhautgeschwürs kann mit einer digitalen Foto-Spaltlampe und der topischen Verabreichung von Fluorescein-Färbung diagnostiziert werden.
Durch ein Elektroretinogramm kann die Progressive Retina-Atrophie festgestellt werden, bevor sie klinisch in Erscheinung tritt. Diese Vorgehensweise ist nicht Teil einer Routineuntersuchung des Auges. Ein DNA-Test für PRA ist verfügbar.
Brachycephalie
Neben der adspektorischen Untersuchung zur Feststellung von Veränderungen, der Kopfform, Nasenlöchern und Kiefer sind meist weitere fachtierärztliche Untersuchungen, bildgebende Verfahren zur Untersuchung des Kopfes und, bei einigen Tieren, des Skelettsystems notwendig, um dem jeweiligen Tier ggf. notwendige medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Mittels Bildgebung wie der Endoskopie können Stenosen, Verengungen im Nasenvorhof, Überlänge und Verdickung des weichen Gaumens, Veränderungen der Luftröhre, sowie übermäßiges Gewebe im Nasen-/Rachen-/Maulraum festgestellt werden.
Mithilfe getesteter Messverfahren kann die Brachycephalie anhand des kraniofazialen Verhältnisses quantifiziert werden. Dazu wird die Schnauzenlänge durch die Schädellänge dividiert. Die Messungen können auch an Röntgenbildern des Schädels vorgenommen werden.
BOAS (Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom)
Die Diagnose basiert auf den Berichten der Tierhalter*innen, der klinischen Untersuchung und diagnostischer Bildgebung. Bildgebende Verfahren wie MRT ermöglichen eine genauere Beurteilung der oberen Atemwege. Neben den verengten Nasenlöchern kann bei der Inspektion eine gewisse Atemanstrengung mit Bauchatmung festgestellt werden. Während das Schnarchen höchstwahrscheinlich durch Luftturbulenzen im oro-pharyngealen Bereich verursacht wird, ist das hohe Geräusch, das mit einer extremen Inspirationsanstrengung einhergeht, auf eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Atemwege zurückzuführen, wenn die turbulente Luft durch den kollabierten Larynx oder Nasopharynx strömt.
Hydrozephalus
Die Diagnose basiert auf der klinischen Untersuchung und bildgebenden Verfahren, wie Röntgen, CT und/oder MRT.
Hauterkrankungen
Je nach Verdachtsdiagnose werden der Anamnese und klinischen Untersuchung entsprechende weiterführende dermatologische Untersuchungen angeschlossen.
Eine Verdachtsdiagnose auf Color Dilution Alopecia kann anhand des Phänotyps erhoben werden. Dilution (ggf. molekulargenetisch bestätigt durch den Befund d/d am Genort Dilution) in Kombination mit Haarausfall, insbesondere am Rumpf (CDA) sowie haarlose Farbplatten am Rumpf auf unverändertem weißen (unpigmentierten) Grund sind pathognostisch. Die endgültige Diagnose wird anhand der histopathologischen Befunde einer Hautbiopsie gestellt. Außerdem kann ein DNA-Test durchgeführt werden.
8. Aus tierschutzfachlicher Sicht notwendige oder mögliche Anordnungen
Entscheidungen über Zucht- oder Ausstellungsverbote sollten im Zusammenhang mit der Belastungskategorie (BK) getroffen werden. Ausschlaggebend für ein Zuchtverbot kann je nach Ausprägung und Befund sowohl der schwerste, d.h. das Tier am meisten beeinträchtigende Befund und dessen Einordnung in eine der Belastungskategorien sein, oder auch die Zusammenhangsbeurteilung, wenn viele einzelne zuchtbedingte Defekte vorliegen. Berücksichtigt werden sollte ggf. auch der individuelle Inzuchtkoeffizient eines Tieres und die Eigenschaft als Trägertier für Risiko-Gene.
Generell sollte auch bei der Zucht von Chihuahuas beachtet werden:
Neben zu beachtenden äußerlichen, anatomischen und funktionellen Merkmalen sowie des Verhaltens beider Zuchtpartner, sollten die Möglichkeiten zuchthygienischer Beratung auf molekulargenetischer Ebene genutzt werden und insbesondere der genetische Inzuchtkoeffizient, der Heterozygotiewert und die Dog Leukocyte Antigene (DLA) für die Rasse bestimmt werden. In zunehmendem Maß können auch sogenannte Matching Tools/Scores die Auswahl geeigneter Zuchtpartner erleichtern.
a) notwendig erscheinende Anordnungen
Zuchtverbot gem. § 11b TierSchG für Tiere mit vererblichen/zuchtbedingten Defekten der Belastungskategorien 2 und 3, mindestens mit
- Patellaluxation
- Mitralklappenerkrankungen
- Chiari-ähnliche Malformation/Syringomyelie
- Augenerkrankungen (Katarakt, ulcerative Keratitis (Hornhautulceration), progressive Retinaatrophie (PRA), Hornhautdystrophie)
- Brachycephalie
- BOAS (Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom ab Grad 1
- Veränderungen des Skelettsystems: Kopf (Schädel)
- Hydrocephalus
- Hauterkrankungen (Color Dilution Alopecia (CDA))
Ausstellungsverbot gem. § 10 TierSchHuV mindestens bei Merkmalen/Symptomen der Belastungskategorie 3.
b) mögliche Anordnungen
- Anordnung zur dauerhaften chirurgischen Unfruchtbarmachung (Sterilisation/ Kastration) gemäß § 11b Abs. 2 TierSchG
- Anordnung von Gen-Testen zur Bestimmung des genomischen Inzuchtkoeffizienten und Heterozygotie-Wertes beider ggf. zur Zucht vorgesehener Tiere
- Nutzung zuchthygienischer Beratung und ggf. so genannter Matching Tools zur Vermeidung ungeeigneter Verpaarungen.
c) Anfragen und Anordnungen (im Rahmen einer Gefahrerforschungsmaßnahme) vor Erteilung einer Zuchtgenehmigung:
- Zuchtverband/Verein
- Züchter
- Populationsgröße der Rasse im Verein/Verband
- Derzeit gültiger Rassenstandard und Zuchtordnung
- Forderungen im Standard / Anatomische Merkmale, die für Krankheiten prädisponieren
- Genomischer (nicht berechneter) Inzuchtkoeffizient des Tieres / der Rasse
- Diversität (HET, DLA)
- Durchschnittlich erreichtes Lebensalter
- Häufigste Todesursache
- Durchschnittliche Wurfgröße
- Welpensterblichkeit
- Anzahl tierärztlicher Interventionen zur Geburtshilfe / Kaiserschnitte insgesamt
Untersuchungen
- freiwillig durchzuführende Untersuchungen
- verpflichtend vor Zuchtverwendung durchzuführende Untersuchungen
Gen-Teste (welche sind verfügbar und für die Rasse verifiziert?)
- freiwillig durchgeführte Gen-Teste
- verpflichtend vor Zuchtverwendung durchzuführende Gen-Teste
Bitte beachten:
Maßnahmen der zuständigen Behörde müssen erkennbar geeignet sein, auch in die Zukunft wirkend Schaden von dem betroffenen Tier und/oder dessen Nachzucht abzuwenden. Es handelt sich im Hinblick auf Art und Bearbeitungstiefe von Anordnungen und Zucht- oder Ausstellungsverboten immer um Einzelfallentscheidungen im Ermessen der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen Normen und der vor Ort vorgefundenen Umstände.
9. Allgemeine tierschutzrechtliche Bewertung
a) Deutschland
Aus rechtlicher Sicht sind Hunde mit den oben beschriebenen Defekten/ Syndromen in Deutschland gemäß §11b TierSchG als Qualzucht einzuordnen.
Begründung:
Gem. § 11b TierSchG ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht bei der Nachzucht oder den Nachkommen u.a.
- erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 1 TierSchG) oder
- die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt (§ 11b Abs. 1 Nr. 2a TierSchG).
Schmerz definiert man beim Tier als unangenehme Sinneswahrnehmung, verursacht durch tatsächliche oder potentielle Verletzung, die motorische oder vegetative Reaktionen auslöst, in einem erlernten Vermeidungsverhalten resultiert und potentiell spezifische Verhaltensweisen verändern kann (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, TierSchG, Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 12 mwN; grds. auch Lorz/Metzger TierSchG 7. Aufl. § 1 Rn. 20).
Leiden sind alle nicht bereits vom Begriff des Schmerzes umfassten Beeinträchtigungen im Wohlbefinden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeitspanne fortdauern (Hirt/Maisack/Moritz/Felde Tierschutzgesetz Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 19 mwN.; Lorz/Metzger, TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 33 mwN). Auch Leiden können physisch wie psychisch beeinträchtigen; insbesondere Angst wird in der Kommentierung und Rechtsprechung als Leiden eingestuft (Hirt/Maisack/Moritz/Felde § 1 TierSchG Rn. 24 mwN; Lorz/Metzger § 1 TierSchG Rn. 37). Ein normales Verhalten ist ein Indiz für Wohlbefinden und Gesundheit; umgekehrt ist z.B. ein eingeschränktes Bewegungsverhalten ein Indiz für Störungen des Wohlbefindens und damit für Leiden (Hirt/Maisack/Moritz/Felde § 1 TierSchG Rn 20).
Ein Schaden liegt vor, wenn der körperliche oder seelische Zustand, in welchem ein Tier sich befindet, vorübergehend oder dauernd zum Schlechteren hin verändert wird (Hirt/Maisack/Moriz/Felde TierSchG Komm. 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 27 mwN; Lorz/Metzger TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 52 mwN), wobei völlig geringfügige Beeinträchtigungen, basierend auf körperlicher oder psychischer Grundlage, außer Betracht bleiben. Ausreichend sind aber auch beispielsweise zuchtbedingte geringfügige Gleichgewichts- oder Stoffwechselstörungen, Störungen beim Sehen oder Hören, bei der Fortbewegung und beim artgemäßen Nahrungserwerbs- oder Sozialverhalten (VG Hamburg a.a.O. Rn. 47 m.w.N.; Gutachten zur Auslegung von § 11b TierSchG v. 02.06.99, S. 8). „Der Sollzustand des Tieres beurteilt sich an Tieren der gleichen Art. Das Fehlen von Körperteilen wird dabei in der Kommentarliteratur regelmäßig als Schaden bewertet“ (VG Hamburg Beschl. v. 4.4.2018, 11 E 1067/18 Rn. 47, so auch Lorz/Metzger TierSchG Komm. § 1 Rn. 52).
Die Zucht von Hunden der Rasse Chihuahua erfüllt den Tatbestand der Qualzucht durch einzelne oder mehrere unter Ziffer 5 im Detail erläuterte Schmerzen, Leiden oder Schäden, insbesondere:
- Schäden am Skelettsystem (Kopf, Wirbelsäule, Gliedmaßen)
- Brachycephalie und brachycephales Atemwegssyndrom (BOAS) und damit verbundenes Leiden
- Syringomyelie/Chiari-ähnliche Malformation
- Herzerkrankungen
- Augenerkrankungen und damit verbundene Schmerzen und Schäden
- Hauterkrankungen und damit verbundene Schmerzen und Leiden
11b Abs. 1 TierSchG sieht vor, dass für den Züchter züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht eine in § 11b Abs. 1 genannte Folge eintritt. Abzustellen ist dabei gemäß der Gesetzesbegründung „auf wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, d.h. Erkenntnisse, deren Kenntnis von einem durchschnittlich sachkundigen Züchter erwartet werden können“ (vgl. BT-Drs. 17/10572, S. 31). Züchterische Erkenntnisse liegen vor, wenn aufgrund allgemein zugänglicher Quellen (insbes. Stellungnahmen von Zuchtverbänden, Fachzeitschriften, -büchern und tierärztlichen Gutachten sowie dem Qualzuchtgutachten des BMEL) bestimmte Erfahrungen mit der Zucht bestimmter Tierrassen bestehen, die sich wegen ihrer Übereinstimmung zu annähernd gesicherten Erkenntnissen verdichten (Lorz/Metzger, Kommentar zum TierSchG § 11b TierSchG Rn. 11). Das Qualzuchtgutachten des BMEL nennt unter Punkt 2.1.1.2 den Chihuahua ausdrücklich unter den betroffenen Rassen beim Qualzuchtmerkmal Brachycephalie.
Das Zuchtverbot des § 11b TierSchG gilt unabhängig davon, ob der Züchter selbst die Möglichkeit der schädigenden Folgen erkannt hat, sondern stellt darauf an, ob die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen von einem sorgfältigen Züchter der jeweiligen Tierart erwarten werden können (vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, Kommentar, § 11b TierSchG Rn. 6).
– Ein wichtiges Indiz für einen erblichen Defekt ist, dass eine Erkrankung oder Verhaltensabweichung bei verwandten Tieren häufiger auftritt als in der Gesamtpopulation der Tierart Hund. Gegen einen Schaden spricht nicht, dass sich die Rasse oder Population über längere Zeit als lebensfähig erwiesen hat (vgl. Lorz/Metzger Kommentar zum TierSchG § 11b Rn. 9).
– Das Verbot gilt unabhängig von der subjektiven Tatseite, also unabhängig davon, ob der Züchter selbst die Möglichkeit der schädigenden Folgen erkannt hat oder hätte erkennen müssen. Wegen dieses objektiven Sorgfaltsmaßstabes kann er sich nicht auf fehlende subjektive Kenntnisse oder Erfahrungen berufen, wenn man die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen von einem sorgfältigen Züchter der jeweiligen Tierart erwarten kann (vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, Kommentar 4. Aufl. 2023, § 11b TierSchG Rn. 6).
– Vorhersehbar sind erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann, wenn ungewiss ist, ob sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen auftreten (vgl. Goetschel in Kluge § 11b Rn. 14).
b) Österreich
Hunde mit den o. beschriebenen Defekten/ Syndromen sind in Österreich gemäß §5 TSchG als Qualzucht einzuordnen
Gegen § 5 des österreichischen TschG verstößt insbesondere, wer „Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen“.
Verkürzung des Gesichtsschädels: Die Zucht mit Hunden, die unter einer massiven Verkürzung des Gesichtsschädels und den damit verbundenen Problemen leiden oder dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn u.a folgende in § 5 aufgezählte Symptome verwirklicht ist: Atemnot, Fehlbildungen des Gebisses.
Augenerkrankungen: Die Zucht mit Hunden, die unter pathologischen Veränderungen der Augen leiden oder genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: Blindheit, Exophthalmus, Einschränkung physiologischer Funktionen durch Entzündungen oder Missbildungen der Augen bzw. ihrer Anhangsgebilde.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Durch die bei der Aufzählung möglicher Defekte gewählte Formulierung “insbesondere” gehören auch Herzerkrankungen bei den Nachkommen zu den klinischen Symptomen, die nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen.
Syringomyelie/Chiari-ähnliche Malformation: Die Zucht mit Hunden, bei denen eine Missbildung des Schädels in Form einer Chiari-ähnlichen Malformation und/oder eine Syringomyelie vorliegt oder die dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: neurologische Symptome, die nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten und damit unter § 5 Abs. 1 TSchG fallen. Die Verkürzung der Lebenserwartung ist überdies vom Begriff der wesentlichen Beeinträchtigung physiologischer Lebensläufe erfasst.
Patellaluxation: Die Zucht mit Hunden, bei denen eine Patellaluxation vorliegt oder die dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: Bewegungsanomalien, Lahmheiten.
c) Schweiz
Wer mit einem Tier züchten will, das ein Merkmal oder Symptom aufweist, das im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu einer mittleren oder starken Belastung führen kann, muss vorgängig eine Belastungsbeurteilung vornehmen lassen. Bei der Belastungsbeurteilung werden nur erblich bedingte Belastungen berücksichtigt (vgl. Art. 5 Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten (TSchZV). Hunde mit Defekten, die der Belastungskategorie 3 zuzuordnen sind, unterliegen gemäß Art. 9 TSchZV einem Zuchtverbot. Ebenso ist es verboten, mit Tieren zu züchten, wenn das Zuchtziel bei den Nachkommen eine Belastung der Kategorie 3 zur Folge hat. Mit Tieren der Belastungskategorie 2 darf gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt (Art. 6 TSchZV). Anhang 2 der TSchZV nennt Merkmale und Symptome, die im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu mittleren oder starken Belastungen führen können. Bewegungsanomalien, degenerative Gelenkveränderungen, Schädeldeformationen mit behindernden Auswirkungen auf die Atemfähigkeit, die Lage der Augen, die Zahnstellung und den Geburtsvorgang, Bandscheibenvorfälle, Fehlfunktionen der Augen sowie persistierende Fontanellen werden ausdrücklich erwähnt. Zudem werden gemäß Art. 10 TSchZV einzelne Zuchtformen ausdrücklich verboten. Unter dieses Verbot fallen gemäß lit. c Zwerghunde, die ausgewachsen weniger als 1500 Gramm wiegen. In den übrigen Fällen wird ein Zuchtverbot jedoch nur im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung ausgesprochen. Tiere, die aufgrund unzulässiger Zuchtziele gezüchtet wurden, dürfen nicht ausgestellt werden (Art. 30a Abs. 4 Bst. b TSchV).
d) Niederlande
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” des Tierhalter-Dekrets verboten, mit Haustieren in einer Weise zu züchten, die dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Elterntiere oder ihrer Nachkommen abträglich ist.
In jedem Fall muss die Zucht so weit wie möglich verhindern, dass
- schwerwiegende Erbfehler und Krankheiten an die Nachkommen weitergegeben werden oder bei ihnen auftreten können;
- äußere Merkmale an die Nachkommen weitergegeben werden oder sich bei ihnen entwickeln können, die schädliche Folgen für das Wohlbefinden oder die Gesundheit der Tiere haben.
Folgende Erbkrankheiten oder Anomalien gemäß Artikel 3.4. sind beim Chihuahua verwirklicht: Brachycephalie, Erkrankungen des Auges, Anomalien des Schädels, Herzklappenerkrankungen.
Es können u.a. folgende schädliche äußere Merkmale an die Nachkommen von Chihuahuas weitergegeben werden: kurze Schnauze, Kleinwuchs (Miniaturrasse).
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” des Tierhalter-Dekrets und Artikel 2 Satz 1 des Dekrets “Zucht mit brachycephalen Hunden” verboten, Hunde zu züchten, deren Schnauze kürzer als ein Drittel der Schädellänge ist und die weitere der oben genannten damit zusammenhängenden Probleme aufweisen: bei der Atmung in Ruhe ein Nebengeräusch erzeugen; mäßige bis starke Verengung der Nasenöffnungen aufweisen; eine Nasenfalte mit Haaren, die von der Nasenfalte aus die Hornhaut oder Bindehaut berühren oder berühren könnten oder die nass ist; Entzündungszeichen in einem oder beiden Augen, die mit dem Vorhandensein der Nasenfalte zusammenhängen; ein Auge mit in zwei oder mehr Quadranten sichtbarem Augenweiß; ein Augenlid, das beim Auslösen des Lidreflexes nicht vollständig geschlossen werden kann.
Ausführliche rechtliche Bewertungen und/ oder Gutachten können, soweit schon vorhanden, auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden.
10. Relevante Rechtsprechung
- Deutschland: Nicht zum Chihuahua, aber zu Brachycephalie beim French Bulldog: VG Stade, Beschluss v. 07.07. 2022, 10 B 481/22 und OVG Lüneburg, Beschluss v. 25.10.2022, 11 ME 221722
- Österreich: Nicht bekannt.
- Schweiz: Nicht bekannt.
- Niederlande: Gericht für Zivilrecht Amsterdam, Urteil vom 4.Juni 2025, Verbot der Ausstellung von Ahnentafeln für brachycephale Rassen. Im Urteil wird der Shih Tzu explizit als eine der Rassen genannt, die keinen Stammbaum mehr erhalten, wenn die Eltern nicht den niederländischen Kriterien entsprechen (s.a. https://qualzucht-datenbank.eu/wp-content/uploads/2025/06/Urteil-brachycephale-Hunde-DE-Juni-2025.pdf ).
- Schweden: Nicht bekannt.
- Norwegen: Nicht zum Chihuahua aber zur Chiari-ähnlichen Malformation: Das Dom Høyesterett als oberstes Berufungsgericht hat am 10.10.2023 festgestellt, dass der Cavalier King Charles Spaniel aufgrund der Vielzahl an schwerwiegenden Erkrankungen – allein bereits aufgrund der Chiari-like Malformation (CM) und der Syringomyelie (SM) – als Qualzucht einzustufen ist (HR-2023-1901-A AZ 23-004643SIV-HRET).
11. Anordnungsbeispiel vorhanden?
Nein.
Anordnungsbeispiele werden ausschließlich auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt.
12. Zuwendungen und Förderungen
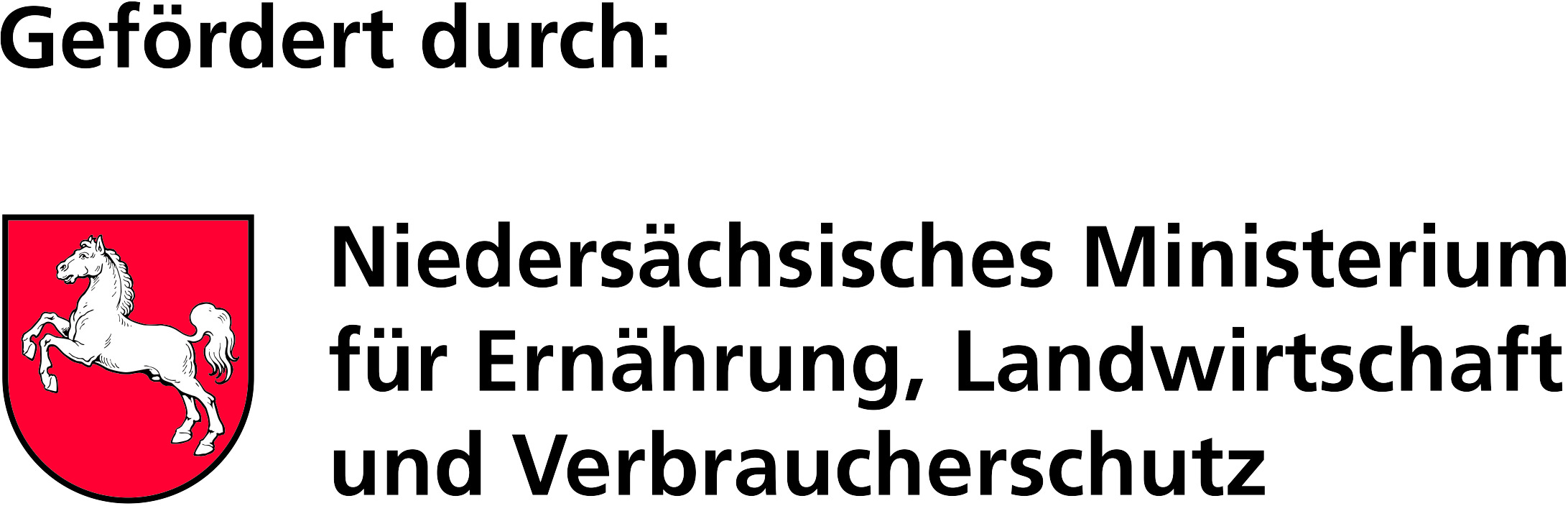
13. Literaturverzeichnis/ Referenzen/ Links
An dieser Stelle wird nur eine Auswahl an Quellen zu den oben beschriebenen Defekten und ggf. allgemeine Literatur zu zuchtbedingten Defekten bei Hunden angegeben. Umfangreichere Literaturlisten zum wissenschaftlichen Hintergrund werden auf Anfrage von Veterinärämtern ausschließlich an diese versendet.
Hinweis: Die Beschreibung von mit dem Merkmal verbundenen Gesundheitsproblemen, für die bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, erfolgen vor dem Hintergrund entsprechender Erfahrungen der Experten und Expertinnen aus der tierärztlichen Praxis, und/oder universitären Einrichtungen, sowie öffentlich frei einsehbaren Datenbanken oder Veröffentlichungen von Tier-Versicherungen und entstammen daher unterschiedlichen Evidenzklassen.
Da Zucht und Ausstellungswesen heutzutage international sind, beziehen sich die Angaben in der Regel nicht nur auf Prävalenzen von Defekten oder Merkmalen in einzelnen Verbänden, Vereinen oder Ländern.
Quellen:
AGRIA Pet Insurance Sweden. (2022). Chihuahua Shorthaired Breed Profiles Veterinary Care 2016-2021.
AGRIA Pet Insurance Sweden. (2022). Chihuahua Longhaired Breed Profiles Veterinary Care 2016-2021.
AGRIA Pet Insurance Sweden. (2022). Chihuahua Shorthaired Breed Profiles Life 2016-2021.
AGRIA Pet Insurance Sweden. (2022). Chihuahua Longhaired Breed Profiles Life 2016-2021.
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. (2015). Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/747/de
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). (2005). Gutachten zur Auslegung von Paragraf 11b des Tierschutzgesetzes (Qualzuchtgutachten). https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Tierschutz/Gutachten-Leitlinien/Qualzucht.html
Dier&Recht. (2019). Kleinste Hunde-die kleinsten Hunde haben die größten Probleme. Dier&Recht. https://www.dierenrecht.nl/sites/default/files/2020-05/rapport-miniatuurhondjes.pdf
Fleming, J. M., Creevy, K. E., & Promislow, D. E. L. (2011). Mortality in North American Dogs from 1984 to 2004: An Investigation into Age‐, Size‐, and Breed‐Related Causes of Death. Journal of Veterinary Internal Medicine, 25(2), 187–198. https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2011.0695.x
Gelatt, K. N., & MacKay, E. O. (2005). Prevalence of primary breed‐related cataracts in the dog in North America. Veterinary Ophthalmology, 8(2), 101–111. https://doi.org/10.1111/j.1463-5224.2005.00352.x
Geiger, M., Schoenebeck, J. J., Schneider, R. A., Schmidt, M. J., Fischer, M. S., & Sánchez-Villagra, M. R. (2021). Exceptional Changes in Skeletal Anatomy under Domestication: The Case of Brachycephaly. Integrative Organismal Biology (Oxford, England), 3(1), obab023. https://doi.org/10.1093/iob/obab023
Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists, (ACVO). (2023). ACVO 2023 The Blue Book—Ocular disorders presumed to be inherited in purebreed dogs- Chihuahua (15th Edition). https://ofa.org/wp-content/uploads/2024/05/ACVO-Blue-Book-2023.pdf
Hale, F. A. (2021). Dental and Oral Health for the Brachycephalic Companion Animal . In Health and Welfare of Brachycephalic (Flat-faced) Companion Animals (1., S. 235–250). Taylor and Francis Group. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429263231-14/dental-oral-health-brachycephalic-companion-animal-fraser-hale
Hirt, A., Maisack, C., Moritz, J., & Felde, B. (2023). Tierschutzgesetz: Mit TierSchHundeV, TierSchNutztV, TierSchVersV, TierSchTrV, EU-Tiertransport-VO, TierSchlV, EU-Tierschlacht-VO, TierErzHaVerbG: Kommentar (4. Auflage). Verlag Franz Vahlen.
Hobi, S., Barrs, V. R., & Bęczkowski, P. M. (2023). Dermatological Problems of Brachycephalic Dogs. Animals, 13(12), 2016. https://doi.org/10.3390/ani13122016
Kiviranta, A. ‐M., Rusbridge, C., Laitinen‐Vapaavuori, O., Hielm‐Björkman, A., Lappalainen, A. K., Knowler, S. P., & Jokinen, T. S. (2017). Syringomyelia and Craniocervical Junction Abnormalities in Chihuahuas. Journal of Veterinary Internal Medicine, 31(6), 1771–1781. https://doi.org/10.1111/jvim.14826
Lorz, A., & Metzger, E. (Hrsg.). (2019). Tierschutzgesetz: Mit Allgemeiner Verwaltungsvorschrift, Art. 20a GG sowie zugehörigen Gesetzen, Rechtsverordnungen und Rechtsakten der Europäischen Union: Kommentar (7. Auflage). C.H. Beck.
Mattin, M. J., Boswood, A., Church, D. B., López‐Alvarez, J., McGreevy, P. D., O’Neill, D. G., Thomson, P. C., & Brodbelt, D. C. (2015). Prevalence of and Risk Factors for Degenerative Mitral Valve Disease in Dogs Attending Primary‐care Veterinary Practices in England. Journal of Veterinary Internal Medicine, 29(3), 847–854. https://doi.org/10.1111/jvim.12591
Mattin, M. J., Boswood, A., Church, D. B., McGreevy, P. D., O’Neill, D. G., Thomson, P. C., & Brodbelt, D. C. (2015). Degenerative mitral valve disease: Survival of dogs attending primary-care practice in England. Preventive Veterinary Medicine, 122, 436–442. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2015.05.007
Meola, S. D. (2013). Brachycephalic Airway Syndrome. Topics in Companion Animal Medicine, 28(3), 91–96. https://doi.org/10.1053/j.tcam.2013.06.004
Niederländische Grundsatzregelung für brachycephale Rassen (2023). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2023-23619.pdf
Niederländischer Staatssekretär für Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovation vom 19. Oktober 2012, Nr. 291872, Direktion für Gesetzgebung und Rechtsfragen. (2024). Niederländisches Tierhalter-Dekret. Tierhalter Dekret. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2024-07-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel3.4
Nilsson, K., Zanders, S., & Malm, S. (2018). Heritability of patellar luxation in the Chihuahua and Bichon Frise breeds of dogs and effectiveness of a Swedish screening programme. The Veterinary Journal, 234, 136–141. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2018.01.010
O’Neill, D. G., Church, D. B., McGreevy, P. D., Thomson, P. C., & Brodbelt, D. C. (2013). Longevity and mortality of owned dogs in England. The Veterinary Journal, 198(3), 638–643. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2013.09.020
O’Neill, D. G., Lee, M. M., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Sanchez, R. F. (2017). Corneal ulcerative disease in dogs under primary veterinary care in England: Epidemiology and clinical management. Canine Genetics and Epidemiology, 4(1), 5. https://doi.org/10.1186/s40575-017-0045-5
O’Neill, D. G., Packer, R. M. A., Lobb, M., Church, D. B., Brodbelt, D. C., & Pegram, C. (2020). Demography and commonly recorded clinical conditions of Chihuahuas under primary veterinary care in the UK in 2016. BMC Veterinary Research, 16(1), 42. https://doi.org/10.1186/s12917-020-2258-1
O’Neill, D. G., Pegram, C., Crocker, P., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Packer, R. M. A. (2020). Unravelling the health status of brachycephalic dogs in the UK using multivariable analysis. Scientific Reports, 10(1), 17251. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73088-y
Orthopedic Foundation for Animals (OFA). (2024). Chihuahua Breed Summary Report 2024. OFA. https://ofa.org/chic-programs/browse-by-breed/?breed=CH
Orthopedic Foundation for Animals (OFA). (o. J.). Patellar Luxation. OFA. Abgerufen 17. April 2024, von https://ofa.org/diseases/patellar-luxation/
Park, S. A., Yi, N. Y., Jeong, M. B., Kim, W. T., Kim, S. E., Chae, J. M., & Seo, K. M. (2009). Clinical manifestations of cataracts in small breed dogs. Veterinary Ophthalmology, 12(4), 205–210. https://doi.org/10.1111/j.1463-5224.2009.00697.x
Ruotanen, P. (2020). Estimation of heritability of patellar luxation in four dog breeds in Finnland. https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/2d37e512-38c1-4738-8075-bbf8f3aa0a54/content
Rusbridge, C., Stringer, F., & Knowler, S. P. (2018). Clinical Application of Diagnostic Imaging of Chiari-Like Malformation and Syringomyelia. Frontiers in Veterinary Science, 5, 280. https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00280
Rusbridge, C. (2020). New considerations about Chiari‐like malformation, syringomyelia and their management. In Practice, 42(5), 252–267. https://doi.org/10.1136/inp.m1869
Sanchis‐Mora, S., Pelligand, L., Thomas, C. L., Volk, H. A., Abeyesinghe, S. M., Brodbelt, D. C., Church, D. B., Thomson, P. C., McGreevy, P. D., & O’Neill, D. G. (2016). Dogs attending primary‐care practice in England with clinical signs suggestive of Chiari‐like malformation/syringomyelia. Veterinary Record, 179(17), 436–436. https://doi.org/10.1136/vr.103651
Schweizerischer Bundesrat. (2024). Tierschutzverordnung (TSchV) Schweiz. FedLex. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/de
Teng, K. T., Brodbelt, D. C., Pegram, C., Church, D. B., & O’Neill, D. G. (2022). Life tables of annual life expectancy and mortality for companion dogs in the United Kingdom. Scientific Reports, 12(1), 6415. https://doi.org/10.1038/s41598-022-10341-6
Universität Utrecht. (2016). PETscan Entwicklung und Einführung eines quantitativen Messsystems für Gesundheit und Wohlbefinden von Haustieren-Erbkrankheiten und schädliche Rassemerkmale bei 38 Hunderassen und 2 Katzenrassen in den Niederlanden. Fakultät für Tierheilkunde von Heimtieren.
https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapportage_ministerie_ez_final_24022017.pdf
Dieses Merkblatt wurde durch die QUEN gGmbH unter den Bedingungen der „Creative Commons – Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ – Lizenz, in Version 4.0, abgekürzt „CC BY-NC-SA 4,0“, veröffentlicht. Es darf entsprechend dieser weiterverwendet werden, Eine Kopie der Lizenz ist unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ einsehbar. Für eine von den Bedingungen abweichende Nutzung wird die Zustimmung des Rechteinhabers benötigt.
Sie können diese Seite hier in eine PDF-Datei umwandeln:





