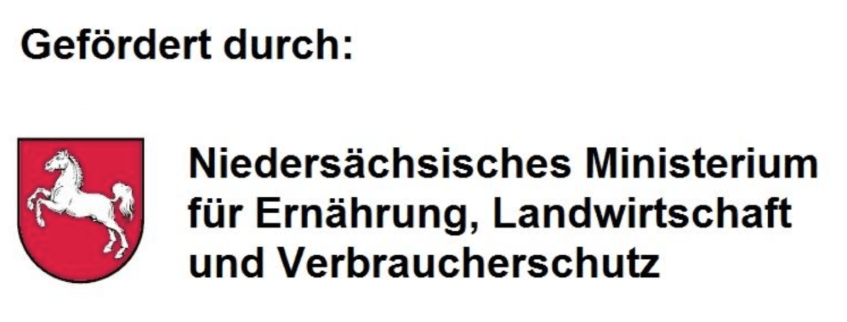Merkblatt Meerschweinchen Fehlendes Haarkleid
Tierart: Meerschweinchen
Defekt: Fehlendes Haarkleid
QUEN-Merkblatt Nr.46
Bearbeitungsstand: 11.08.2025
Tierart: Meerschweinchen
Defekt: Fehlendes Haarkleid
QUEN-Merkblatt Nr. 46
Bearbeitungsstand vom 11.08.2025
1. Beschreibung des Typs/Defekts
Haarlose oder teilbehaarte Meerschweinchen (Skinnys/Skinnies), sind entweder am gesamten Körper nackt oder haben bspw. auf der Nase oder an den Beinen noch Haare. Bei solchen Tieren können zugleich entweder vollständig oder teilweise die Vibrissen fehlen.
Skinnys haben sehr wenige Haare, die sich auf die Körperregionen Kopf, Beine und Füße beschränken. Geboren werden sie entweder mit extrem reduzierter Behaarung oder vollkommen haarlos. Im Laufe des Lebens kann sich die Behaarung bei dieser Rasse immer wieder ändern und sie können mal mehr oder weniger Körperbehaarung aufweisen. Ursache ist eine Mutation der Haarfollikel. Skinnys können in unterschiedlichen Farbvariationen auftreten. Haarlose Meerschweinchen haben kleinere Erythrozyten und eine geringere Anzahl an Lymphozyten.
Baldwins werden vollständig behaart geboren und verlieren während der ersten Lebenswochen alle Haare und meist auch die Vibrissen. Etwa sechs Wochen nach der Geburt sind sie vollständig haarlos. Ihnen fehlen dann auch die Wimpern und Vibrissen. Es sind sehr empfindliche und krankheitsanfällige Tiere. Während offenbar nicht alle Skinnys ein geschwächtes Immunsystem haben, scheint das bei den Baldwins durchweg der Fall zu sein und sie haben eine deutlich geringere Lebenserwartung.
Der Europäische Dachverband der Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazüchter (EE) erkennt Skinnys seit Mai 2024 als Rasse an. Baldwins sind weder in Deutschland noch in der EU eine von Zuchtverbänden anerkannte Rasse.
2.1 Bild 1

Skinny Meerschweinchen
Foto: QUEN-Archiv
2.1 Bild 2

Skinny-Meerschweinchen
Foto: QUEN-Archiv
Weitere Fotos finden Sie hier (Bild anklicken):
3. Vorkommen bei anderen Tierarten
Hunde, Katzen, Mäuse, Ratten.
4. Mit dem Merkmal möglicherweise verbundene Probleme/Syndrome
- Immundefizienz
- unzureichende Thermoregulation und dadurch
- höherer Stoffumsatz/Energieverbrauch (ggfs. verbunden mit gastrointestinalen Störungen durch höhere Futter- und Energieaufnahme)
- fehlender UV-Schutz
- Hautirritationen, Hautverletzungen (Bisse, Fremdkörper)
- Hyperkeratose und Faltenbildung der Haut
- fehlende/veränderte/verkürzte Vibrissen
5. Symptomatik und Krankheitswert der oben genannten Defekte: Bedeutung/Auswirkungen des Defektes auf das physische/psychische Wohlbefinden (Belastung) des Einzeltieres u. Einordnung in Belastungskategorie*
*Die einzelnen zuchtbedingten Defekte werden je nach Ausprägungsgrad unterschiedlichen Belastungskategorien (BK) zugeordnet. Die Gesamt-Belastungskategorie richtet sich dabei nach dem jeweils schwersten am Einzeltier festgestellten Defekt. Das BK-System als Weiterentwicklung nach dem Vorbild der Schweiz ist noch im Aufbau und dient lediglich der Orientierung. Daher sind die hier angegebenen BK-Werte als vorläufig anzusehen. Dies vor allen Dingen deshalb, weil sich im deutschen Tierschutzgesetz keine justiziable Grundlage zur Einteilung in Belastungskategorien findet. Im Gegensatz zur Schweiz werden in den gesetzlichen Normen in Deutschland Schmerzen, Leiden oder Schäden nicht quantifiziert oder ihrer Qualität nach beurteilt, sondern dann berücksichtigt, wenn sie das Tier mehr als nur unwesentlich beeinträchtigen.
Die Belastungen, welche durch Defekt-Zuchtmerkmale entstehen können, werden in 4 Kategorien eingeteilt (Art. 3 TSchZV, Schweiz). Für die Zuordnung eines Tieres zu einer Belastungskategorie ist das am stärksten belastende Merkmal oder Symptom entscheidend (Art. 4 TSchZV, Schweiz).
Kategorie 0 (keine Belastung): Mit diesen Tieren darf gezüchtet werden.
Kategorie 1 (leichte Belastung): Eine belastende Ausprägung von Merkmalen und Symptomen bei Heim- und Nutztieren kann durch geeignete Pflege, Haltung oder Fütterung ohne Eingriffe am Tier und ohne regelmäßige medizinische Pflegemaßnahmen kompensiert werden.
Kategorie 2 (mittlere Belastung): Mit diesen Tieren darf ggf. nur gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt.
Kategorie 3 (starke Belastung): Mit diesen Tieren darf nicht gezüchtet werden.
Mit dem Merkmal Haarlosigkeit können folgende Auswirkungen auf das physische und psychische Wohlbefinden auftreten (siehe auch Merkblatt Nr. 2 Katze Haarkleid, Merkblatt Nr. 20 Katze Vibrissen und Merkblatt Nr. 4 Hund Fehlendes Haarkleid):
Physisch:
Immundefizienz
Die Haarlosigkeit kann, je nach Zuchtlinie, mit Veränderungen des Thymus (athymotisch oder hypothymotisch) und damit auch mit Veränderungen des Immunsystems einhergehen. Athymotische Tiere entwickeln anstelle des Thymus zystisch verändertes Gewebe. Jedoch können Skinnys durchaus auch euthymotisch sein. Aus Versuchstierlinien ist bekannt, dass die Haarlosigkeit zu einer Reduktion des germinalen Gewebes/der germinalen Strukturen in Lymphknoten und intestinalem lymphatischem Gewebe führen, oder dieses vollständig fehlen kann. Auch Hypogammaglobulinämien wurden in der Tierversuchsliteratur beschrieben. In den 1970er Jahren sollen vor allem euthymotische, also thymusintakte haarlose Meerschweinchen in den Heimtiermarkt gelangt sein. Es konnte gezeigt werden, dass haarlose Meerschweinchen kleinere Erythrozyten und eine geringere Anzahl an Lymphozyten besitzen.
Aus empirischen Beobachtungen in der tierärztlichen Praxis lässt sich feststellen, dass haarlose Meerschweinchen offenbar häufiger als behaarte Tiere Immundefizienzen aufweisen und deshalb empfindlichere und krankheitsanfälligere Tiere häufiger mit der Rasse „Skinny“ in Verbindung gebracht werden. Immundefizienzen können zu einem frühzeitigen Versterben der Tiere aufgrund von Infektionen führen. Aus diesem Grunde werden haarlose Meerschweinchen oft nicht älter als drei Jahre, bei einer maximalen Lebenserwartung von acht Jahren bei behaarten Rassen. Zudem haben sie einen kleineren Wuchs, eine schrumpelige, z.T. verdickte, hyperkeratotische, oft auch trockene Haut und fehlende oder verkümmerte Vibrissen. Phänotypisch lassen sich athymotische oder hypothymotische haarlose Meerschweinchen nicht von euthymotischen haarlosen Meerschweinchen unterscheiden.
Thermoregulation
Die Thermoregulation unbehaarter oder wenig behaarter Tiere muss vor allen Dingen über eine erhöhte Energiezufuhr und einen erhöhten Stoffwechsel sichergestellt werden. Aufgrund des mangelnden Schutzes vor höheren oder niedrigeren Temperaturen können diese Tiere nicht in Außenhaltung untergebracht werden. Haarlose Meerschweinchen bevorzugen höhere Umgebungstemperaturen (30-38 °C), als behaarte (24-30°C). Bei kühleren Temperaturen müssen sich die Tiere in warme und gepolsterte Unterschlüpfe zurückziehen können, unter Umständen müssen ihnen Anzüge angepasst werden. Praxiserfahrungen zeigen, dass Halter:innen von haarlosen Meerschweinchen diesen auch Pullover anziehen.
Grundumsatz und Energieverbrauch
Wie von anderen Tierarten bekannt, haben auch Skinnys einen höheren Futterbedarf, weil sie nur durch eine deutliche Steigerung von Energiezufuhr und Stoffumsatz den Energieverlust in Form von Wärme kompensieren können.
Fehlender UV-Schutz
Haare und Fell gewährleisten einen besonders hohen UV-Schutz, der bei Mäusen mit über 90% angegeben ist. Haarlose Meerschweinchen verfügen über keinen ausreichenden Schutz vor äußeren Einflüssen, insbesondere vor höheren und niedrigeren Temperaturen und vor UV-Strahlung.
Hautirritationen und Hautverletzungen
Durch den fehlenden Hautschutz sind haarlose Tiere einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt, von beißenden Artgenossen und Einrichtungsgegenstände verletzt zu werden als behaarte Tiere. Geht mit der Haarlosigkeit ein reduziertes Immunsystem einher, sind die Tiere empfänglicher für z.T. schwer verlaufende Infektionskrankheiten. Die trockene und hyperkeratotische Haut benötigt oft zusätzliche Pflegemaßnahmen. Oft wird in Ratgebern und Foren die Anwendung milder Cremes empfohlen.
Fehlende/veränderte/verkürzte Vibrissen
Aufgrund der Mutation können die Vibrissen teilweise oder vollständig fehlen, sie können strukturell verändert (gekräuselt, gewellt) sein oder abbrechen. Durch die fehlenden oder veränderten Vibrissen wird das sensorische System der Tiere hinsichtlich der Wahrnehmung, Übertragung und Verarbeitung mechanischer Reize erheblich eingeschränkt. Damit kann die Orientierung im Raum und die Erfassung von Umweltstrukturen verändert/reduziert sein.
Meerschweinchen haben physiologischerweise suborbitale (über den Augen), mystaciale (über den Lippen) und rhinale (an der Nase) Vibrissen. Um den Nasenbereich befinden sich vier abgespreizte und fünf in Reihe stehende Vibrissen. Die Vibrissen des Meerschweinchens ähneln denen von Ratten und Mäusen, obwohl sie weniger bewegt werden und die Tiere eher bodenbewohnend sind. Hausmeerschweinchen sind in ihrem Verhalten den Wildformen noch ähnlich und haben mehrere Aktivitätsphasen, wenn auch überwiegend tag- und dämmerungsaktiv. Sie besitzen große, empfindliche Follikel und können ihre Vibrissen mit einer komplexen Muskelarchitektur bewegen, was darauf hindeutet, dass die Schnurrhaare bei ihnen eine wichtige Funktion haben. Als Nestflüchter können die Tiere ihre Tasthaare von Geburt an ähnlich gut bewegen wie adulte Tiere.
Es wird davon ausgegangen, dass die Vibrissen beim Meerschweinchen sowohl für die Fortbewegung als auch zum Schutz der Augen und für soziale Berührungen eine Rolle spielen. Meerschweinchen sind sehr soziale Tiere, die in großen Gruppen leben und ziemlich komplexe soziale Verhaltensweisen zeigen. Es ist wahrscheinlich, dass die Schnurrhaare bei ihnen eine wichtige Rolle bei aggressiven und unterwürfigen Interaktionen spielen.
Die Wildformen der Meerschweinchen sind dämmerungs- und nachtaktiv. Als Beutetiere halten sich die Wildformen nur in kurzen Distanzen von hoher Vegetation oder anderen schützenden Strukturen wie Höhlen u.ä. auf. Innerhalb der Vegetation legen sie sogenannte Vegetationstunnel und Trampelpfade an. Da Meerschweinchen nicht so gut sehen können, orientieren sie sich insbesondere im Dunkeln mit Hilfe der Tasthaare. Vibrissen übertragen mechanische Reize (Spannung, Druck, Bewegung, Vibrationen) über Rezeptoren an die entsprechenden Hirnareale. Je nachdem, ob es sich um passive oder aktive Vibrissen handelt, sind sie entweder für die Stabilisierung der wahrnehmenden Organismen/Individuen und der Wahrnehmung von Störungen verantwortlich oder sie werden aktiv für das Tracking, also die Wahrnehmung der Umwelt (Oberflächenstruktur externer Objekte) eingesetzt. Tasthaare liefern Informationen über die Distanz von Objekten, deren Lokalisation, Orientierung und generelle Charakteristiken der Oberflächenstruktur (Textur und Umrandung).
Augenerkrankungen
In einer US-amerikanischen Studie hatten haarlose Meerschweinchen signifikant häufiger mucopurulenten Augenausfluss durch eine Infektion mit Pasteurellen als behaarte Tiere. Auch Trichiasis, Keratitis mit Hornhautvaskularisation und Fremdkörper traten im Vergleich zu behaarten Tieren häufiger auf.
Psychisch:
Nacktmeerschweinchen müssen aufgrund ihres höheren Energieverbrauchs deutlich höhere Mengen Futter aufnehmen und scheiden dadurch auch deutlich mehr aus als Tiere mit einer unveränderten Thermoregulation. Durch die notwendige höhere Stoffwechselleistung werden die Organe bspw. die Nieren zusätzlich belastet. Der notwendige Energie- und Nährstoffbedarf kann dennoch nie ausreichend gedeckt werden, da die Haarlosigkeit ein Dauerzustand ist. Damit wird den Tieren eine Leistung abverlangt, der sie nur durch eine Anpassung des Verhaltens, also eine erhöhte Futteraufnahme, begegnen können. Da bereits behaarte Meerschweinchen die meiste Zeit des Tages mit Kauen und Futteraufnahme beschäftigt sind, ist es naheliegend, dass mit einer Erhöhung der Futteraufnahmemenge die Ruhezeiten der Tiere verkürzt werden.
Bei einem erhöhten Futterbedarf durch einen höheren Stoffumsatz, kann es bei der Futteraufnahme zu verstärkten Stresssituationen durch Nahrungskonkurrenz kommen.
Eine erhöhte Exposition der Haut, z.B. bei Rangeleien innerhalb der Gruppe, kann bei beißenden Artgenossen den Stress für haarlose Tiere erhöhen. Infolgedessen müssen sie sich eher zurückziehen, um Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Vibrissen sind für Meerschweinchen ein wichtiges sensorisches Organ zur Orientierung, also zur Erfassung und Bewertung des Lebensumfeldes. Fehlende oder veränderte Vibrissen beeinträchtigen die sensorische Leistungsfähigkeit. Fehlen sie völlig, kann das Meerschweinchen auf dieses Sensorium zur Erschließung und Bewertung des Umfeldes/der Umwelt nicht oder nur reduziert zurückgreifen. Die Vibrissen stellen wichtige Mechanorezeptoren dar und ermöglichen es Meerschweinchen, sich auch bei geringem Lichteinfall in ihrem Umfeld sicher zu bewegen und zu orientieren (s. auch unter Physisch).
Belastungskategorie insgesamt: 3
6. Vererbung, Genetik, ggf. bekannte Gen-Teste
Die Haarlosigkeit trat bei beiden “Rassen” ursprünglich durch zwei unterschiedliche spontane Genmutationen auf, die beide rezessiv vererbt werden. Für dermatologische Studien etablierten kanadische Forschende die haarlosen Meerschweinchen, die später als Skinnys in der Heimtierszene bekannt und beliebt wurden. Hierfür kreuzten sie Albino Hairless Guinea Pigs mit behaarten Tieren. Baldwins gingen aus einer Spontanmutation von White Crested Meerschweinchen einer Züchterin in den USA hervor.
7. Diagnose – weitergehende Untersuchungen
Die Haarlosigkeit bzw. reduzierte Behaarung ist als offensichtliches phänotypisches Merkmal ohne Weiteres adspektorisch erkennbar. Schwieriger ist das Erkennen von Tieren, die nur Träger des Skinny-Erbgutes sind. Äußerlich sind sie u.U. nicht von normal behaarten Meerschweinchen unterscheidbar. Die sich aus einer mangelnden Pflege und inadäquaten Haltung ergebenden Erkrankungen bei haarlosen Meerschweinchen oder solchen mit deutlich reduzierter Behaarung lassen sich im Rahmen einer üblichen klinischen Diagnostik feststellen. So kann z.B. die teilweise reduzierte Behaarung auch auf organische Erkrankungen (z.B. hormonelle Dysfunktion aufgrund von Ovarialzysten) zurückzuführen sein. Eine gründliche Anamnese und Evaluation von Differentialdiagnosen ist ggf. vor geplanter Zuchtverwendung nötig, um mögliche Trägertiere zu identifizieren.
8. Aus tierschutzfachlicher Sicht notwendige oder mögliche Anordnungen
Entscheidungen über Zucht- oder Ausstellungsverbot können auch in diesem Fall im Zusammenhang mit der Belastungskategorie (BK) getroffen werden. Ausschlaggebend für ein Zuchtverbot kann je nach Ausprägung und Befund sowohl der schwerste, d.h. das Tier am meisten beeinträchtigende Befund und dessen Einordnung in eine der Belastungskategorien (BK) sein, oder auch die Zusammenhangsbeurteilung, wenn viele einzelne zuchtbedingte Defekte vorliegen.
a) notwendig erscheinende Anordnungen
Zuchtverbot (auf § 11b gestützte Anordnung nach § 16a (1) S.1), da es sich um haarlose Tiere handelt und dieser Defekt mit weiteren negativen Folgen für das Tier verbunden ist.
Ausstellungsverbot bei Vorliegen entsprechender oben beschriebener Merkmale besteht beim betroffenen Tier aufgrund der sichtbaren Veränderung der Verdacht einer Qualzucht gem. §11b TierSchG. Deshalb wird empfohlen, die Vorstellung des Tieres zur Ausstellung und Bewertung aller Art zu untersagen.
b) mögliche Anordnungen
Vollständiges Verbot der Zucht von und mit haarlosen Meerschweinchen oder teilbehaarten oder Trägertieren. Die Verwendung dieser Tiere ist auch dann nicht möglich, wenn z.B. durch Verpaarung mit behaarten Tieren die nachfolgenden Generationen mehr Haare haben sollen. Denn es ist nicht absehbar, inwiefern sich die Haarlosigkeit später doch wieder zeigen kann.
Bitte beachten:
Maßnahmen der zuständigen Behörde müssen erkennbar geeignet sein, auch in die Zukunft wirkend Schaden von dem betroffenen Tier und/oder seiner Nachzucht abzuwenden. Es handelt sich im Hinblick auf Art und Bearbeitungstiefe von Anordnungen und Zuchtverboten immer um Einzelfallentscheidungen im Ermessen der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung der vor Ort vorgefundenen Umstände.
9. Allgemeine tierschutzrechtliche Bewertung
a) Deutschland
Aus tierschutzrechtlicher Sicht sind Meerschweinchen mit den oben beschriebenen Defekten/Syndromen in Deutschland gemäß §11b TierSchG als Qualzucht einzuordnen.
Begründung:
Gem. § 11b TierSchG ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht bei der Nachzucht oder den Nachkommen u.a.
- erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 1 TierSchG) oder
- mit Leiden verbundene erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 2 a) TierSchG) oder
- die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt (§ 11b Abs. 1 Nr. 2 c) TierSchG).
Schmerz definiert man beim Tier als unangenehme Sinneswahrnehmung, verursacht durch tatsächliche oder potentielle Verletzung, die motorische oder vegetative Reaktionen auslöst, in einem erlernten Vermeidungsverhalten resultiert und potentiell spezifische Verhaltensweisen verändern kann (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, TierSchG, Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 12 mwN; grds. auch Lorz/Metzger TierSchG 7. Aufl. § 1 Rn. 20).
Leiden sind alle nicht bereits vom Begriff des Schmerzes umfassten Beeinträchtigungen im Wohlbefinden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeitspanne fortdauern (Hirt/Maisack/Moritz/Felde Tierschutzgesetz Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 19 mwN.; Lorz/Metzger, TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 33 mwN). Auch Leiden können physisch wie psychisch beeinträchtigen; insbesondere Angst wird in der Kommentierung und Rechtsprechung als Leiden eingestuft (Hirt/Maisack/Moritz/Felde § 1 TierSchG Rn. 24 mwN; Lorz/Metzger § 1 TierSchG Rn. 37).
Anerkannt ist, dass das Nichtausübenkönnen arteigener Verhaltensweisen als Leiden eingestuft wird (vgl. die Ausführungen des VG Hamburg 11. Kammer im Beschluss vom 04.04.2018, 11 E 1067/18 zum Leiden bei fehlenden Tasthaaren bei Sphynx-Katzen sowie die Ausführungen im sog. Qualzuchtgutachten Kapitel 1.3.7. ).
Ein Schaden liegt vor, wenn der körperliche oder seelische Zustand, in welchem ein Tier sich befindet, vorübergehend oder dauernd zum Schlechteren hin verändert wird (Hirt/Maisack/Moritz/Felde TierSchG Komm. 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 27 mwN; Lorz/Metzger TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 52 mwN), wobei völlig geringfügige Beeinträchtigungen, basierend auf körperlicher oder psychischer Grundlage, außer Betracht bleiben. „Der Sollzustand des Tieres beurteilt sich an Tieren der gleichen Art. Das Fehlen von Körperteilen wird dabei in der Kommentarliteratur regelmäßig als Schaden bewertet“ (VG Hamburg Beschl. v. 4.4.2018, 11 E 1067/18 Rn. 47, so auch Lorz/Metzger TierSchG Komm. § 1 Rn. 52).
Die Zucht von Meerschweinchen erfüllt den Tatbestand der Qualzucht durch die einzelnen oder mehreren unter Ziffern 5 und 6 im Detail erläuterten Schäden, Schmerzen und Leiden aufgrund von:
- vollständigem oder teilweisem Fehlen von Vibrissen als Sinnesorgan
- teilweiser oder vollständiger Funktionslosigkeit von Vibrissen als Sinnesorgan
- veränderter Mechanorezeption aufgrund fehlender oder veränderter Vibrissen
- Fehlen oder Funktionseinschränkung des Haarkleides und damit verbunden: fehlender Hautschutz, welcher Hautirritationen und Hautverletzungen (Bisse, Fremdkörper) begünstigt, unzureichende Thermoregulation, welche wiederum u.a zu höherem Stoffumsatz/Energieverbrauch führt (ggfs. verbunden mit gastrointestinalen Störungen durch höhere Futter- und Energieaufnahme) und fehlender UV-Schutz.
- Immundefizienz
- verkürzter Lebenserwartung
- Hyperkeratose und Faltenbildung der Haut
- Einschränkung des arteigenen Ausdrucksverhaltens
- Augenerkrankungen
Ein Tier mit einer genetisch bedingten Abweichung des Haarkleides, seiner Tasthaare oder genetisch bedingten völligen Haarlosigkeit, ist bereits gemäß dem sogenannten Qualzuchtgutachten (2000) als Qualzucht klassifiziert: Haut und Haarkleid des Tieres sind Körperorgane, die für artgerechtes Verhalten und physiologische Vorgänge von erheblicher Bedeutung sind und wichtige Funktionen erfüllen (vgl. Qualzuchtgutachten, S. 11 sowie auch Hirt/Maisack/Moritz, TierschG, § 11 b Rn. 4;). Das Haarkleid dient dem Schutz der Körperhaut und der Thermoregulierung (vgl. Qualzuchtgutachten, S. 12).
Beim Fehlen des Haarkleides ist von einer von § 11b Abs. 1 Nr. 1 TierSchG umfassten Umgestaltung des Körperorgans Haut auszugehen. Es fehlen den mit diesem Defekt behafteten Meerschweinchen also nicht lediglich die Haare, sondern das Körperteil „Haut“ wurde durch Mutation umgestaltet, und dadurch die Abwesenheit von Haaren auf einem überwiegenden Teil des Körpers bewirkt (vgl. VG Weimar, Beschl. v. 27. Juni 2019, 1E 810/19 We; Hirt/Maisack/Moritz, TierschG, § 11 b Rn. 4).Haarkleid und Tasthaare des Tieres sind Körperorgane, die für artgerechtes Verhalten von erheblicher Bedeutung sind; Ausdrucksverhalten und Verteilung von Duftstoffen sind unmöglich oder eingeschränkt . Die erhebliche Einschränkung des arteigenen Ausdrucks- und Kommunikationsverhaltens führt zu Verhaltensstörung und ist damit als Leiden zu werten.
Über die Tasthaare werden außerdem Berührungsreize an das Gehirn übertragen, die den Tieren u. a. zur Orientierung dienen. Die Einschränkung dieser Funktion führt ebenfalls zu Leiden.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass auch sehr gute Halte- und Pflegebedingungen und angepasste Haltungsbedingungen (zusätzliche Wärmequellen, Tierkleidung, Deckung des höheren Futter- und Energiebedarfs) nicht zu einem Wegfall der Qualzuchtmerkmale nach § 11b TierSchG führen; ein Qualzuchtmerkmal lässt sich nicht durch Haltungsbedingungen „heilen“.
Das Verbot gilt unabhängig von der subjektiven Tatseite, also unabhängig davon, ob der Züchter selbst die Möglichkeit der schädigenden Folgen erkannt hat oder hätte erkennen müssen (Lorz/Metzger § 11b Rn. 4). Wegen dieses objektiven Sorgfaltsmaßstabes kann er sich nicht auf fehlende subjektive Kenntnisse oder Erfahrungen berufen, wenn man die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen von einem sorgfältigen Züchter der jeweiligen Tierart erwarten kann.
b) Österreich
Meerschweinchen mit den oben beschriebenen Defekten/Syndromen sind in Österreich gemäß § 5 TSchG als Qualzucht einzuordnen
Gegen § 5 des österreichischen TschG verstößt insbesondere*, wer „Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen“.
*Das Wort „insbesondere“ bedeutet, dass die Liste nicht vollständig, sondern beispielhaft ist.
Die Zucht mit Meerschweinchen, die unter folgenden Defektmerkmalen und den damit verbundenen Problemen leiden oder die dafür genetisch prädisponiert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren.
Der § 5 Abs. 2 TSchG nennt als Qualzuchtsymptome insbesondere:
- Einschränkung physiologischer Funktionen durch teilweise oder gänzlich fehlendes Haarkleid,
- Entzündungen der Haut,
- Einschränkung physiologischer Funktionen durch Entzündungen oder Missbildungen der Augen bzw. deren Anhangsgebilde,
- neurologische Symptome oder Funktionsverlust von Sinnesorganen,
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich sind eindeutig und schließen Tiere, die Qualzuchtmerkmale aufweisen, von der Zucht sowie auch von Erwerb oder Ausstellung aus. Einzelne Rassen werden im Gesetz nicht angeführt.
c) Schweiz
Wer mit einem Tier züchten will, das ein Merkmal oder Symptom aufweist, das im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu einer mittleren oder starken Belastung führen kann, muss vorgängig eine Belastungsbeurteilung vornehmen lassen. Bei der Belastungsbeurteilung werden nur erblich bedingte Belastungen berücksichtigt (vgl. Art. 5 Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten (TSchZV)). Tiere mit Defekten, die der Belastungskategorie 3 zuzuordnen sind, unterliegen gemäß Art. 9 TSchZV einem Zuchtverbot. Ebenso ist es verboten, mit Tieren zu züchten, wenn das Zuchtziel bei den Nachkommen eine Belastung der Kategorie 3 zur Folge hat. Mit Tieren der Belastungskategorie 2 darf gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt (Art. 6 TSchZV). Anhang 2 der TSchZV nennt Merkmale und Symptome, die im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu mittleren oder starken Belastungen führen können. Übermässige Faltenbildung, Missbildung/Fehlen der Tasthaare und Fehlfunktion der Augen werden ausdrücklich erwähnt. Zudem werden gemäß Art. 10 TSchZV einzelne Zuchtformen ausdrücklich verboten. In den übrigen Fällen wird ein Zuchtverbot jedoch nur im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung ausgesprochen. Tiere, die aufgrund unzulässiger Zuchtziele gezüchtet wurden, dürfen nicht ausgestellt werden (Art. 30a Abs. 4 Bst. b TSchV).
Ausführliche rechtliche Bewertungen und/oder Gutachten können, soweit schon vorhanden, auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden.
10. Relevante Rechtssprechung
Deutschland: noch nicht zum Skinny-Meerschweinchen, aber zu Katze und Hund mit fehlendem Fell und/oder Vibrissen:
Katze: VG Berlin, Urteil vom 23. September 2015, 24K 202.14
VG Hamburg, Beschluss vom 04. April 2018, 11 E 1067/18
VG Oldenburg, Beschluss vom 05. September 2024, 5 B 2114/24
Hund: OVG Weimar, Beschluss vom 3. März 2021, 3 EO 509/19, 3 ZO 553/19 (Hauptverfahren noch nicht abgeschlossen).
VG Weimar, Beschluss vom 27. Juni 2019, 1E 810/19 We
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 12. Juli 2022, 11 ME 134/22
Mehrere weitere Gerichtsverfahren sind anhängig:
VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 06.01.2025 – 16 L 470/24 (noch nicht rechtskräftig).
VG Lüneburg, Urteil vom 08.08.24 – 6 A 226/21 (noch nicht rechtskräftig).
Österreich: noch nicht zum Skinny-Meerschweinchen, aber zum Hund mit fehlendem Fell und/oder Vibrissen:
Landesverwaltungsgericht Steiermark, Beschwerdeabweisung vom 16. März 2022, LVwG 30.9-60/2021-37
Verwaltungsgerichtshof Wien, Erkenntnis vom 18.November 2024, Ro 2022/02/0016-5
Schweiz: nicht bekannt.
11. Anordnungsbeispiel vorhanden?
Nein.
Anordnungsbeispiele werden ausschließlich auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt.
12. Förderungen und Zuwendungen
13. Literaturverzeichnis/ Referenzen/ Links
An dieser Stelle wird nur eine Auswahl an Quellen zu den oben beschriebenen Defekten und ggf. allgemeine Literatur zu zuchtbedingten Defekten bei Hunden angegeben. Umfangreichere Literaturlisten zum wissenschaftlichen Hintergrund werden auf Anfrage von Veterinärämtern ausschließlich an diese versendet.
Hinweis: Die Beschreibung von mit dem Merkmal verbundenen Gesundheitsproblemen, für die bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, erfolgen vor dem Hintergrund entsprechender Erfahrungen der Experten und Expertinnen aus der tierärztlichen Praxis, und /oder universitären Einrichtungen, sowie öffentlich frei einsehbaren Datenbanken oder Veröffentlichungen von Tier-Versicherungen und entstammen daher unterschiedlichen Evidenzklassen.
Da Zucht und Ausstellungswesen heutzutage international sind, beziehen sich die Angaben in der Regel nicht nur auf Prävalenzen von Defekten oder Merkmalen in einzelnen Verbänden, Vereinen oder Ländern.
Quellen:
American Hairless Cavy Society. (o.A.). Considerations for Breeding. Considerations for Breeding. https://web.archive.org/web/20180524004237/http://www.ahcs-online.com/breeding.php
Banks, R. (1989). The guinea pig: Biology, care, identification, nomenclature, breeding, and genetics. https://netvet.wustl.edu/species/guinea/guinpig.txt
Birmelin, I., & Giel, O. (2014). Meerschweinchen: So fühlen sie sich rundum wohl (Aktualisierte Neuausg., 1. Aufl). Gräfe und Unzer.
Entente Europeenneeenne. (2025). Europäischer Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel , Kaninchen- und Caviazucht—Standards. Entente Europeenne d`Aviculture et de Cuniculture. https://entente-ee.eu/wp-content/uploads/EE-standard-D-2024.pdf
Grant, R. A., Delaunay, M. G., & Haidarliu, S. (2017). Mystacial Whisker Layout and Musculature in the Guinea Pig ( Cavia porcellus ): A Social, Diurnal Mammal. The Anatomical Record, 300(3), 527–536. https://doi.org/10.1002/ar.23504
Grant, R. A., Breakell, V., & Prescott, T. J. (2018). Whisker touch sensing guides locomotion in small, quadrupedal mammals. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 285(1880), 20180592. https://doi.org/10.1098/rspb.2018.0592
Grant, R. A., & Goss, V. G. A. (2022). What can whiskers tell us about mammalian evolution, behaviour, and ecology? Mammal Review, 52(1), 148–163. https://doi.org/10.1111/mam.12253
Kaiser, S., Krüger, C., & Sachser, N. (2024). The guinea pig. In H. Golledge & C. Richardson (Hrsg.), The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research Animals (1. Aufl., S. 465–483). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119555278.ch27
Kleven, G. A., & Joshi, P. (2016). Temperature Preference in IAF Hairless and Hartley Guinea Pigs (Cavia porcellus). Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 55(2) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4783634/pdf/jaalas2016000161.pdf
Laabs, A., & Koch, C. (2025). Beobachtungen aus der Praxis und persönliche Mitteilung von Dr. Christian Koch, Tierarzt, Zuchtrichter für den MFD BD e.V. und Vertreter des MFD BD e.V. in der EE.
Pignon, C., & Mayer, J. (2021). Guinea Pigs. In Ferrets, Rabbits, and Rodents (S. 270–297). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-48435-0.00021-6
Quesenberry, K. E., Orcutt, C. J., Mans, C., & Carpenter, J. W. (Hrsg.). (2021). Ferrets, rabbits, and rodents: Clinical medicine and surgery (Fourth edition). Elsevier.
Reed, C., & O’Donoghue, J. L. (1979). A new guinea pig mutant with abnormal hair production and immunodeficiency. Laboratory Animal Science, 29(6), 744–748. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/529772/
Schillinger, V. (2025). Qualzucht beim Meerschweinchen: Nacktmeerschweinchen. Meerschweinchenwiese. https://meerschweinchenwiese.de/nachwuchs/qualzuchten#Weiterfuehrende_Links
Schneider, B., Döring, D., & Ketter, D. (Hrsg.). (2017). Verhaltensberatung bei kleinen Heimtieren: Haltung, Normalverhalten und Behandlung von Verhaltensproblemen (S. b-005-148981). Schattauer GmbH. https://doi.org/10.1055/b-005-148981
Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT). (2020). Merkblatt_159_Meerschweinchen. https://www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/#c270
Waner, T., Avidar, Y., Peh, H., Zass, R., & Bogin, E. (1996). Hematology and Clinical Chemistry Values of Normal and Euthymic Hairless Adult Male Dunkin‐Hartley Guinea Pigs ( Cavia porcellus ). Veterinary Clinical Pathology, 25(2), 61–64. https://doi.org/10.1111/j.1939-165X.1996.tb00971.x