Tierart: Hund
Rasse: Deutsche Dogge
QUEN-Merkblatt Nr. 37
Bearbeitungsstand: 30.07.2025
Tierart: Hund
Rasse: Deutsche Dogge
QUEN-Merkblatt Nr. 37
Bearbeitungsstand: 30.07.2025
1. Beschreibung der Tiere
FCI Rassestandard* Nr.: 235
Äußeres Erscheinungsbild und laut Standard geforderte, kritische Merkmale:
Laut Rassestandard besitzt die Deutsche Dogge einen großen und kräftigen Körperbau mit ausgeprägter Bemuskelung. Die geforderten Mindestgrößen (Widerristhöhe bei Rüden: 80 cm, bei Hündinnen: 72 cm) führen zu einer Riesenrasse mit langen Beinen (Gigantismus).
Farbe: Die Deutsche Dogge wird innerhalb der FCI-Verbände in drei selbstständigen Varietäten gezüchtet. Varietät 1: Gelb und Gestromt. Varietät 2: Schwarz-Weiß gefleckt (“Harlekindogge”), Schwarz-Grau gefleckt (“Grautiger”) und Schwarz. Varietät 3: Blau. Weiße Abzeichen sind bei schwarzen und gefleckten Doggen als “Manteldoggen” und als “Plattenhunde” von bestimmten Vereinen zugelassen. Außerhalb der FCI-Zucht werden auch Doggen anderer Farbschläge gezüchtet (z.B. Fawnequin, Brindlequin etc.).
Achtung: eine Formulierung in der Überarbeitung des Rassestandards vom August 2024 in welcher gefordert wurde, dass das untere Augenlid dem Bulbus anliegen muss, wurde wieder geändert und lautet in der jetzt gültigen Version (Oktober 2024): “AUGEN: Mittelgroß, mit lebhaftem, klugem, freundlichem Ausdruck, möglichst dunkel, mandelförmig mit gut anliegenden Lidern.”
*Rassestandards und Zuchtordnungen haben im Gegensatz zu TierSchG und TierSchHuV keine rechtliche Bindungswirkung.
2.1 Bild 1

Deutsche Dogge. Ektropium.
Foto: QUEN-Archiv
2.1 Bild 2

Deutsche Dogge. Ektropium.
Foto: QUEN-Archiv
Weitere Fotos finden Sie hier (Bild anklicken):
3. In der Rasse häufig vorkommende Probleme/Syndrome
Von mehreren bei dieser Rasse gehäuft vorkommenden Problemen und Erkrankungen, werden an dieser Stelle nur die wichtigsten rassetypischen Defekte und möglicherweise auftretenden Erkrankungen aufgeführt:
Bei der Deutschen Dogge sind folgende rassetypische Defekte oder gehäuft vorkommende Probleme/ Gesundheitsstörungen und Dispositionen* bekannt:
* (bitte dazu auch die bereits vorhandenen Merkblätter zu einzelnen Defekten wie insbesondere Merkblatt Nr. 11 Hund Entropium und Merkblatt Nr. 32 Hund Ektropium beachten).
- Herzerkrankungen
- Erkrankungen des Bewegungsapparates
- Fellpigmentierung und angeborene Taubheit
- Augenerkrankungen
- Primäre Hypothyreose
- Hauterkrankungen
- Erkrankungen des Verdauungstraktes
4. Weitere ggf. gehäuft auftretende Probleme
In der veterinärmedizinischen Fachliteratur finden sich neben den unter Punkt 3 angegebenen rassetypischen Defekten Hinweise zum Vorkommen folgender Probleme, die nachfolgend nicht weiter ausgeführt werden, da noch keine abschließenden Schlussfolgerungen aus den bekannt gewordenen Prävalenzen gezogen werden können und durch Züchter, Zuchtvereine und -verbände keine unter wissenschaftlichen Kautelen erhobenen Prävalenzen angegeben werden. Für diese Fälle ist jedoch die folgende Aussage von Hale (2021) zutreffend: “The absence of evidence is not the evidence of absence”.
- Chronische Hepatitis
- Demodikose
- Diskospondylitis
- Epidermolysis bullosa aquisita (bullöse Autoimmunerkrankung)
- Erbliche Myopathie der Deutschen Dogge
- Geburtsschwierigkeiten (Dystokie, Perinatale Mortalität)
- Glaukom
- Hypertrophe Osteodystrophie
- Hypoadrenokortizismus
- Kalziumphosphat-Ablagerungen
- Katarakt
- Kryptokokken
- Leckgranulom
- Mikrocornea
- Mikrophthalmus
- Milztorsion
- Mitralklappendysplasie
- Nickhautknorpeleversion
- Panostitis
- Persistierender rechter Aortenbogen
- Primärer orthostatischer Tremor
- Progressive Retinaatrophie (PRA)
- Retinadysplasie
- Subaortenstenose
- Trikuspidalklappendysplasie
- Uveale Zysten
- Dentitionskrankheiten
- Zink-responsive Dermatose
5. Symptomatik und Krankheitswert einiger Defekte: Bedeutung/Auswirkungen des Defektes auf das physische/ psychische Wohlbefinden (Belastung) des Einzeltieres u. Einordnung in Belastungskategorie∗
*Die einzelnen zuchtbedingten Defekte werden je nach Ausprägungsgrad unterschiedlichen Belastungskategorien (BK) zugeordnet. Die Gesamt-Belastungskategorie richtet sich dabei nach dem jeweils schwersten am Einzeltier festgestellten Defekt. Das hier verwendete BK-System als Weiterentwicklung nach dem Vorbild der Schweiz (das bedeutet, die Beurteilung kann von der Einteilung in der Schweiz abweichen) ist noch im Aufbau und ist das Ergebnis tierschutzfachlicher Beurteilung. Daher sind die hier vorgenommenen BK-Werte als vorläufig anzusehen und bieten bis zu einer angestrebten länderübergreifenden Definition eine Unterstützung zur ersten Orientierung. So werden z.B. Funktionseinschränkungen von Sinnesorganen je nach Ausprägung der Belastungskategorie 2-3 zugeordnet.
In der Schweiz werden die Belastungen, die durch Zuchtmerkmale entstehen können, in 4 Kategorien eingeteilt (Art. 3 TSchZV, Schweiz). Für die Zuordnung eines Tieres zu einer Belastungskategorie ist das am stärksten belastende Merkmal oder Symptom entscheidend (Art. 4 TSchZV, Schweiz).
Kategorie 0 (keine Belastung): Mit diesen Tieren darf gezüchtet werden.
Kategorie 1 (leichte Belastung): Eine leichte Belastung liegt vor, wenn eine belastende Ausprägung von Merkmalen und Symptomen bei Heim- und Nutztieren durch geeignete Pflege, Haltung oder Fütterung, ohne Eingriffe am Tier und ohne regelmäßige medizinische Pflegemaßnahmen kompensiert werden kann.
Kategorie 2 (mittlere Belastung): Mit diesen Tieren darf ggf. nur gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt.
Kategorie 3 (starke Belastung): Mit diesen Tieren darf nicht gezüchtet werden.
Anmerkung vorab zu den bei dieser Rasse möglicherweise festgestellten zuchtbedingten Defekten: Zucht- und Ausstellungswesen sind heute international. Da keine belastbaren Prävalenzen zu Defektmerkmalen durch Züchter, Zuchtvereine und -verbände vorgelegt werden, wird die verfügbare internationale wissenschaftliche Literatur ausgewertet.
Herzerkrankungen
Dilatative Kardiomyopathie und Vorhofflimmern
Physisch:
Die Dilatative Kardiomyopathie (DCM) ist eine Erkrankung des Herzens. Sie hat eine lange präklinische Phase, sodass Symptome erst im Erwachsenenalter ausgebildet werden. DCM betrifft eine Vielzahl an mittelgroßen bis großen reinrassigen Hunden. In einer Studie mit 37 Hunden waren Deutsche Doggen die zweithäufigste betroffene Rasse. In einer weiteren Studie mit 107 Deutschen Doggen wurde eine DCM-Prävalenz von 35,9 % festgestellt. Eine andere Studie mit 59 Deutschen Doggen beschreibt eine DCM-Prävalenz von 11,9%. Besonders häufig sind Rüden betroffen.
Die DCM ist auch bei Deutschen Doggen durch erweiterte Herzkammern, Herzschwäche (es kann eine links- oder beidseitige Schwäche vorliegen), Vorhofflimmern und systolische Dysfunktion gekennzeichnet. Bei einer fortschreitenden Herzinsuffizienz besteht besonders für die Deutsche Dogge im Vergleich zu anderen Rassen ein hohes Risiko, frühzeitig zu sterben oder euthanasiert werden zu müssen. In einer Studie mit 367 Hunden mit DCM hatten Deutsche Doggen die kürzeste mediane Überlebenszeit von 5 Wochen ab dem Erkennen von klinischen Symptomen.
Die Krankheit beginnt mit Herzrhythmusstörungen oder mit einer verminderten Fähigkeit des Herzmuskels, vollständig zu kontrahieren und genügend Blut zu pumpen. Als klinische Symptome der DCM werden Herzgeräusche, Husten, eine reduzierte Bewegungstoleranz, Gewichtsverlust, Aszites (Bauchwassersucht) und der sogenannte Galopprhythmus des Herzens (unregelmäßiger Herzrhythmus) beschrieben. Elektrokardiographische Auffälligkeiten bei Deutschen Doggen mit DCM sind Vorhofflimmern und ventrikuläre Extrasystolen. Röntgenologisch können Lungenödeme, generalisierte Herzvergrößerung, Vergrößerung des linken Vorhofs und Pleuraergüsse beobachtet werden. Zusätzlich werden Hunde mit DCM durch folgende Symptome auffällig: Atemnot, schwacher Puls, Kollaps und Blässe der Schleimhaut.
Bei Deutschen Doggen mit DCM wird auch in vielen Fällen Vorhofflimmern beobachtet. Vorhofflimmern ist die häufigste Arrhythmie bei Hunden. Sekundäres Vorhofflimmern, das durch eine Herzerkrankung bedingt ist, tritt häufig bei großen Hunderassen auf. Die größten Risikofaktoren für die Entstehung sind die Vergrößerung des linken und des rechten Herzvorhofs. Im Fall der DCM bei Deutschen Doggen ist häufig der linke Vorhof vergrößert. Bei Deutschen Doggen wird aber auch häufig primäres Vorhofflimmern beobachtet. Dies dürfte auf die anlagebedingt größeren Vorhof-Dimensionen zurückzuführen sein. Die Überlebenschancen beim primären sind höher als beim sekundären Vorhofflimmern.
Laut dem Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA hatten Deutsche Doggen zwischen 2016 und 2021 ein ca. 4-fach höheres Risiko, Herzerkrankungen zu entwickeln, verglichen mit dem Durchschnitt aller anderen dort versicherten Hunderassen. Das Risiko für Herzarrhythmien war im Vergleich zu den anderen bei AGRIA versicherten Rassen ca. 8-fach erhöht.
Der Breed Summary Report der Orthopedic Foundation for Animals (OFA) für die Jahre 2016-2024 weist eine Prävalenz von positiv auf Herzerkrankungen getesteten Deutschen Doggen zwischen 2 und 6% aus.
Psychisch:
Hunde mit DCM leiden an Schwäche und Appetitlosigkeit. Durch die reduzierte Bewegungstoleranz kommt es zu einer Einschränkung des Normalverhaltens und einem geringeren Aktivitätslevel. Dyspnoe verursacht Angst und schränkt ebenfalls das Aktivitätslevel ein. Zudem kommt es durch den verfrühten Tod zum größtmöglichen Schaden für das Tier.
Belastungskategorie: 3
Erkrankungen des Bewegungsapparates
Hüftgelenksdysplasie
Physisch:
Hüftgelenksdysplasie kann bei allen Hunderassen auftreten, v.a. aber bei großen bis sehr großen Hunderassen, wie der Deutschen Dogge. Im Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA ergab sich für Deutsche Doggen im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Rassen zwischen 2016 und 2021 ein fast 4-fach erhöhtes relatives Risiko für Skeletterkrankungen, die ursächlich für Probleme des Bewegungsapparates waren. Das relative Risiko für solche Probleme im Bereich der Hüfte, des Femurs und/oder Beckens war leicht erhöht. Die OFA gibt in ihrer Teststatistik eine Prävalenz für Hüftdysplasie bei der Deutschen Dogge von ca. 13 % an.
Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk, bei dem der Oberschenkelkopf passgenau in die Hüftpfanne gleitet. Seine Stabilität wird durch straffe Bänder, die Gelenkkapsel und die umgebende Oberschenkelmuskulatur gewährleistet. Zusätzlich sorgt die Gelenkflüssigkeit für eine reibungsfreie Bewegung und dämpft Belastungen. Bei einer Hüftgelenksdysplasie ist dieses Zusammenspiel gestört, da der Oberschenkelkopf nicht richtig in die Hüftpfanne passt. Die Gelenkdegeneration bei der Hüftgelenksdysplasie wird oft durch verzögerte enchondrale Ossifikation erklärt. Unvollständig verknöcherte Hüftstrukturen sind anfälliger für Deformationen und Schäden durch normale Gelenkbewegungen. Dadurch wird das Gelenk instabil und übermäßig beweglich, was zu einer ungleichmäßigen Belastung und zu Schmerzen führt. Die Symptome können durch schwaches Bindegewebe und unzureichend stabilisierende Muskeln und Bänder weiter verstärkt werden. Bei Deutschen Doggen sind in den meisten Fällen beide Hüftgelenke betroffen.
Bei einer Hüftgelenksdysplasie kommt es zu einer verminderten Tragfähigkeit und Bewegungsfunktion des Gelenks. Dies überlastet andere Körperregionen und verursacht Schäden an Knorpel, Bändern, Knochen und der Gelenkkapsel. Im Verlauf können diese Schäden zu Arthritis, Osteoporose und chronischen Gelenkerkrankungen führen. In schweren Fällen treten Risse in Bändern, Verdickungen der Gelenkkapsel und Abnutzungen des Gelenkknorpels auf, wobei der darunterliegende Knochen verhärtet und geschädigt werden kann.
Hüftgelenksdysplasie bei Deutschen Doggen ist eine multifaktorielle Erkrankung, bei der die genetische Veranlagung eine entscheidende Rolle spielt. Diese Veranlagung kann durch verschiedene äußere Einflüsse wie eine übermäßige Wachstumsrate, ungeeignete Bewegungsmuster, Übergewicht und eine unausgewogene Ernährung verstärkt werden. Bei manchen Hunden beginnen die Symptome bereits im Alter von vier Monaten. Andere entwickeln die Krankheit erst im höheren Alter – häufig zusammen mit Osteoarthritis.
Zur Klinik einer Hüftgelenksdysplasie bei Deutschen Doggen gehören: der so genannte Lämmerschwanz, „Hoppelgang“ (Bunny Hopping) oder schwankender Gang, knirschende Geräusche im Gelenk während der Bewegung, Rückgang der Oberschenkelmuskulatur, deutliche Hypertrophie der Schultermuskulatur zur Kompensation der Schwäche des Rückens.
Psychisch:
Hunde mit Hüftgelenksdysplasie zeigen oft verminderte Aktivität, einen eingeschränkten Bewegungsumfang sowie Schwierigkeiten oder Widerstand beim Klettern, Springen, Laufen oder Treppensteigen. Dies beeinträchtigt das Wohlbefinden des Hundes, da seine Fähigkeit, sich auszudrücken und mit seiner Umgebung zu interagieren, stark eingeschränkt ist, was zu Frustration, Stress und Verhaltensänderungen führt.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägung
Ellenbogendysplasie
Physisch:
Ellbogendysplasie (ED) ist eine häufige Ursache für fortschreitende, zu Verkrüppelung führende Arthrose bei Hunden und tritt gehäuft bei großen Hunderassen auf. Als schnellwachsende, sehr große Hunderasse ist die Deutsche Dogge für eine ED prädisponiert. Je nach Studie liegt die Prävalenz zwischen ca. 5 und ca. 20 % .
Der Begriff „Ellbogendysplasie“ beschreibt drei Entwicklungsstörungen: Osteochondrose/Osteochondritis dissecans (OC/OCD) des Humeruskondylus, nicht verknöcherter Processus anconeus und fragmentierter Processus coronoideus. Diese Erkrankungen betreffen häufig den Ellenbogen vieler großer und sehr großer Hunderassen und zeigen viele klinische Gemeinsamkeiten. Die Läsionen sind oft beidseitig und es können mehrere Krankheitsprozesse gleichzeitig im selben Hund sowie im selben Gelenk auftreten. Besonders häufig werden Osteochondrose/Osteochondritis dissecans (siehe nachfolgendes Kapitel) und fragmentierter Processus coronoideus gleichzeitig diagnostiziert. Die Anamnese, die klinischen Signale und Symptome sind bei allen drei Erkrankungen ähnlich. Klinische Symptome entstehen durch eine akute Gelenkentzündung sowie eine fortschreitende degenerative Gelenkerkrankung des Ellenbogens. Bereits im Alter von unter einem Jahr können die Hunde Lahmheit zeigen, die intermittierend auftritt und sich bei Bewegung oder beim ersten Aufstehen nach längerer Ruhepause verstärken kann. Betroffene Hunde stehen oder sitzen oft mit nach außen gedrehtem Karpalgelenk und Pfoten sowie mit abduziertem Ellenbogen. Während des Laufens lässt der Hund den Unterarm häufig kreisen. Eine vollständige Beugung oder Streckung des Ellenbogens kann Schmerzen auslösen. In fortgeschrittenen Stadien können Krepitation, Verdickung der Gelenkkapsel und Bewegungseinschränkungen auftreten. In manchen Fällen ist eine chirurgische Korrektur der Fehlstellung bereits bei jungen Tieren notwendig.
Bei der Entstehung der ED spielen viele Faktoren eine Rolle. Dazu gehören genetische Veranlagung, Ernährungsstörungen wie Über- oder Unterversorgung, Wachstumsstörungen, hormonelle Einflüsse und auch Traumata.
Psychisch:
Betroffene Hunde leiden unter Schmerzen und einer Einschränkung ihrer Motorik, was wiederum zu Verhaltensänderungen und Einschränkungen im Alltag führen kann. Sie zeigen oft Lahmheit, Bewegungseinschränkungen und können beim Aufstehen oder bei bestimmten Bewegungen Schmerzen haben. Diese Beschwerden beeinträchtigen nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das Wohlbefinden und das Verhalten der Hunde.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägung
Osteochondrose/Osteochondrosis dissecans
Physisch:
Bei der Osteochondrose handelt es sich um eine Störung der enchondralen Verknöcherung. Dabei sind sowohl der unreife Knorpel an den Enden der wachsenden Knochen als auch die Wachstumsplatte der Knochen betroffen. Die Erkrankung kann im Ellenbogen-, Schulter-, Knie- und Sprunggelenk auftreten und betrifft vor allem große Hunderassen im Alter von 4 bis 10 Monaten. Eine Prädisposition für männliche Tiere wird beschrieben und wird sowohl mit hormonellen als auch mit wachstumsbedingten Geschlechterunterschieden in Zusammenhang gebracht.
Die Deutsche Dogge ist als große, schnell wachsende Hunderasse für eine Osteochondrose prädisponiert und häufig an mehr als einem Gelenk betroffen. Der Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA zeigt, dass Deutsche Doggen zwischen 2016 und 2021 ein ca. 6-fach höheres Risiko hatten, an OCD zu erkranken als der Durchschnitt der dort versicherten Hunderassen. Für lokomotorische Probleme der Schulter war das Risiko ca. doppelt so hoch und für Arthritis ca. 4-fach gegenüber dem Durchschnitt aller anderen Rassen. Laut der OFA hatten zwischen 2010 und 2020 4-20% der getesteten Doggen Schultererkrankungen. Eine Schulterdysplasie wiesen 5,7% der getesteten Tiere auf.
Osteochondrosis dissecans (OCD) ist eine Erkrankung, bei der es zu einer aseptischen Nekrose von Knorpel und Knochen kommt, insbesondere bei den wachsenden langen Knochen. Sie beginnt mit Unregelmäßigkeiten im Prozess der Knorpelverkalkung, meist im Bereich des Oberarmkopfes. Diese Veränderungen führen dazu, dass der Knorpel nicht richtig verdichtet und dicker wird. Durch die vermehrte Dicke des Knorpels sterben Chondrozyten ab, was die normale Knochenstruktur im tieferen Bereich des Knorpels beeinträchtigt. Der Verlust der Chondrozyten in den tieferen Schichten führt zu Rissen im Knorpel, an denen sich lose Knorpelstücke, sogenannte „Gelenkmäuse“, bilden. Diese freien Fragmente und die entzündlichen Mediatoren gelangen in die Gelenkflüssigkeit und können Arthritis sowie degenerative Gelenkerkrankungen verursachen.
Die genaue Ursache der OCD ist noch nicht vollständig geklärt, aber es gibt Hinweise darauf, dass Faktoren wie Vererbung, schnelles Wachstum, Anatomie, Verletzungen und eine schlechte bzw. unausgewogene Ernährung eine Rolle spielen können.
Klinisch zeigt sich die Erkrankung hauptsächlich durch Lahmheit, die häufig nach körperlicher Belastung auftritt. Hunde mit dieser Erkrankung können eine Steifheit in den Gliedmaßen, einen verminderten Bewegungsradius der betroffenen Extremität, eine verkürzte Schrittlänge und eventuell Schwellungen mit oder ohne Überwärmung in den betroffenen Gelenken zeigen. Zudem kann es sein, dass die Tiere bestimmte Bewegungen vermeiden.
Psychisch:
Bei einer Osteochondrose können über einen Zeitraum von Wochen bis Monaten erhebliche Schmerzen auftreten. Ohne chirurgische Behandlung können diese Schmerzen zu dauerhaften Beschwerden und Einschränkungen führen, die durch die sich entwickelnde Arthrose entstehen. Die Schmerzintensität kann von leicht bis stark variieren. Zudem kann das allgemeine Wohlbefinden des Hundes durch tierärztliche Untersuchungen, Behandlungen, Narkosen und Operationen beeinträchtigt werden, zum Beispiel durch Nebenwirkungen von nichtsteroidalen Entzündungshemmern auf den Magen-Darm-Trakt. Um die Heilung des Gewebes zu fördern, wird oft eine vorübergehende Einschränkung der Aktivität empfohlen, was die Fähigkeit des Hundes, ein normales Leben und Verhalten zu zeigen, beeinflussen kann.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägung
Osteosarkom
Physisch:
Das Osteosarkom ist der häufigste primäre Knochentumor bei Hunden. Bei großen Hunderassen sitzt der Tumor zu 95% in den Gliedmaßen. Bei Deutschen Doggen häufiger in den vorderen Gliedmaßen als in den hinteren. Osteosarkome treten vor allem bei großen und riesigen Hunderassen auf, darunter auch die Deutsche Dogge. Je nach Studie liegt die Prävalenz für die Erkrankung zwischen 0,87% und 4,4% mit einem 34-fach erhöhten Risiko für die Entwicklung eines Osteosarkoms im Vergleich zu Mischlingshunden. Bei Deutschen Doggen werden Tumorerkrankungen im Durchschnitt jedoch bereits im Alter von 6 Jahren diagnostiziert. Damit zählen sie zu den am frühesten betroffenen Hunderassen.
Das aggressive Wachstum von Osteosarkomen führt zu Veränderungen wie Knochenschwund und/oder übermäßige Knochenbildung. Diese Veränderungen schwächen den Knochen. Um dem entgegenzuwirken, bildet der Körper zusätzliches Gewebe, das zur Verdickung und Verhärtung des Knochens führt.
Das Osteosarkom ist bekannt für seine stark ausgeprägte Neigung zur Metastasierung. Bei 85 bis 90 % der Hunde mit dieser Diagnose treten Metastasen auf. Die Metastasen verbreiten sich über den Blutweg hauptsächlich in die Lunge, aber auch in andere Knochengewebe, innere Organe, das Gehirn, das Unterhautfettgewebe und die Haut. Metastasen sind die Hauptursache für tödliche Krankheitsverläufe.
Die Ursache von Osteosarkomen ist weitgehend unbekannt. Es wird angenommen, dass verschiedene Faktoren wie Umweltbedingungen, erbliche Veranlagung und erworbene genetische Mutationen miteinander interagieren und das Auftreten von Osteosarkomen beeinflussen. Rasse, Körpergewicht, eine längere Bein- oder Schädellänge sowie der Kastrationsstatus sind Risikofaktoren für die Entwicklung von Osteosarkomen bei Deutschen Doggen.
Die meisten Hunde mit einem Osteosarkom zeigen vor der Diagnose Anzeichen wie Lahmheit und Schwellungen an der betroffenen Stelle.
Psychisch:
Osteosarkome führen zu Schmerzen und vermindern somit die Lebensqualität des betroffenen Hundes. Durch die Bewegungseinschränkung kommt es zu einer reduzierten Aktivität und Einschränkungen im Verhalten. Zudem kommt es durch den verfrühten Tod zum größtmöglichen Schaden für das Tier.
Belastungskategorie: 3
Cervikale Spondylomyelopathie (Wobbler-Syndrom)
Physisch:
Von der cervikalen Spondylomyelopathie (CSM) sind vor allem große Hunderassen betroffen, wobei die Deutsche Dogge zu den meistbetroffenen Hunderassen zählt. Bei Deutschen Doggen sind vor allem junge Hunde zwischen vier und elf Monaten betroffen. Die Prävalenz von CSM bei Deutschen Doggen, die in nordamerikanischen Lehrkrankenhäusern vorgestellt wurden, lag bei 4,2%.
Die Entwicklung der Halswirbel bei Hunden ist komplex und kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Besonders anfällig für Veränderungen sind die Wachstumsfugen der Wirbel, die erst mit etwa sechs Monaten vollständig geschlossen sind. Störungen in dieser Entwicklung können durch Faktoren wie Ernährungsfehler, Überfütterung oder übermäßige Kalziumzufuhr, abnormale Kräfte auf die Halswirbelsäule und genetische Faktoren wie Wachstumsgeschwindigkeit und Körperform des Hundes verursacht werden.
Cervikale Spondylomyelopathie oder Wobbler-Syndrom beschreibt das Auftreten von Entwicklungsanomalien, die die Halswirbelsäule betreffen und verschiedene Probleme hervorrufen. Die Ursachen der cervikalen Spondylomyelopathie (CSM) bei Hunden sind unbekannt, werden jedoch als multifaktoriell angenommen. Eine Studie widerlegte die Hypothese, dass Unterschiede in der Körperkonformation in Bezug auf Kopfgröße, Halslänge sowie Körperhöhe und -länge eine Rolle in der Entstehung der cervikalen Spondylomyelopathie spielen. Es wird vermutet, dass bei Deutschen Doggen ein genetischer Faktor eine Rolle bei der Entstehung der Krankheit spielt, da sie oft frühzeitig erkranken und in bestimmten Linien eine höhere Häufigkeit der Krankheit zu beobachten ist. Allerdings ist es schwierig, einen klaren genetischen Zusammenhang zu bestimmen, weil die klinischen Symptome und die Ergebnisse der bildgebenden Untersuchungen nicht immer übereinstimmen. Das bedeutet, dass die Veränderungen, die auf den Bildern zu sehen sind, nicht immer mit der Schwere der Symptome übereinstimmen.
Beim Wobbler-Syndrom bei Hunden kommt es zur Kompression des Rückenmarks im Bereich der Halswirbelsäule. Es können verschiedene Arten von Kompressionen des Rückenmarks auftreten, darunter Verengungen des Wirbelkanals durch Fehlbildungen oder Bandscheibenverlagerungen. Zusätzlich führen strukturelle Veränderungen wie eine Hypertrophie des Ligamentum flavum oder des dorsalen Anulus sowie eine übermäßige Beweglichkeit der Wirbelgelenke zu einer weiteren Einengung des Spinalkanals, insbesondere bei Bewegung oder Beugung des Halses.
In einer Studie mit 224 Hunden zeigte sich, dass bei Deutschen Doggen die Hauptursache für die Kompression des Rückenmarks eine Verengung des Wirbelkanals im vorderen Bereich war. Zusätzlich kam es zu einer Verdickung des Bandscheibenrings, wodurch die Bandscheibe an Höhe zunahm. Diese Veränderungen traten an den Stellen auf, wo die Verengung des Kanals am stärksten war, jedoch wurden ähnliche Probleme auch an angrenzenden Wirbelgelenken festgestellt. Die Deutsche Dogge, mit der markanten Nackenwulst hinter ihrem Kopf, zeigt oft Läsionen im mittleren Halsbereich.
Es werden zwei verschiedene Formen der CSM unterschieden: die knochenbedingte Form (Ossär-assoziierte Cervikale Spondylomyelopathie (OA-CSM)), die hauptsächlich bei Deutschen Doggen und anderen Riesenrassen auftritt, und die bandscheibenbedingte Form (discogene cervikale Spondylomyelopathie (DA-CSM)). Bei OA-CSM wird die Kompression des Rückenmarks und der Nervenwurzeln durch eine Verengung des Wirbelkanals verursacht, die durch knöcherne Wucherungen an den Wirbelbögen, den Gelenkfortsätzen und/oder den Wirbelpedikeln entsteht. Diese Form der cervikalen Spondylomyelopathie (OA-CSM) ist mit Arthrose der Halswirbel verbunden.
Bei jungen Deutschen Doggen zeigen sich häufig Veränderungen in den Wirbeln, die zu einer Verengung des Wirbelkanals und Druck auf das Rückenmark führen. Besonders auffällig sind Wachstumsstörungen in den Wirbelkörpern, die zu einer Instabilität der Wirbelgelenke führen. Dies begünstigt eine Lockerung und Veränderung der Gelenkflächen. Bei älteren Tieren treten ähnliche Veränderungen auf, allerdings werden sie oft durch degenerative Schäden an den Gelenken und zusätzlichen Druck auf das Rückenmark verschärft.
Betroffene Deutsche Doggen zeigen oft Ataxie und eine breite Stellung der Hintergliedmaßen, verbunden mit Koordinationsproblemen wie Überkreuzen der Beine oder Schwierigkeiten aufzustehen, zu wenden oder sich beim Harn- und Kotabsetzen richtig zu positionieren. Bei fortgeschrittenen Fällen treten Propriozeptionsdefizite (mangelnde Wahrnehmung der Gliedmaßenposition), Hypermetrie (übermäßig ausgreifender Gang) und Krallenschleifen auf, manchmal begleitet von Spastik der Vorderbeine oder Hyperreflexie der Hinterbeine. Die erheblichen Gangstörungen verursachen schwere Behinderungen und Schmerzen bei den betroffenen Hunden.
Junge Hunde zeigen vor allem progressive Ataxie, einen breiten Gang der Hinterbeine und propriozeptive Defizite.
Psychisch:
Durch die Gangstörungen kommt es zu Schmerzen für betroffene Tiere und dadurch zu Einschränkungen im Verhalten und der Aktivität.
Belastungskategorie: 3
Fehlende Fellpigmentierung und angeborene Taubheit
Physisch:
Vererbte Taubheit bei Deutschen Doggen steht in engem Zusammenhang mit der Fellpigmentierung. Drei Genloci spielen für die Pigmentierung eine zentrale Rolle: der S-Lokus (Piebald), der M-Lokus (Merle) und der H-Lokus (Harlekin).
Die Piebald- und Merle-Gene beeinflussen die Pigmentierung von Hunden, indem sie die Melanozyten, die Zellen, die für die Produktion von Farbstoffen verantwortlich sind, unterdrücken. Dies führt im Fall von Piebald zu mehr oder weniger ausgedehnten pigmentlosen Körperarealen (das pigmentlose Haar erscheint in diesen Bereichen weiß). Im Fall von Merle führt es je nach Genotyp zu farbverdünnten Bereichen, schwarzes Pigment wird z.B. im Genotyp M/m zu einer charakteristischen zerrissen wirkenden Verteilung von schwarzen und grauen Flecken modifiziert (mehr dazu siehe QUEN-Merkblatt Nr. 6 Hund Merle-Syndrom). In einigen Fällen kann sowohl eine Weißscheckung im Kopfbereich als auch ein Merle-Genotyp dazu führen, dass die Iris des Auges blau wird. Der Harlekin-Faktor führt im heterozygoten Genotyp H/h zu einer weiteren Aufhellung der bereits durch Merle verdünnten Fellareale zu weiß. Auf Fellfarben ohne Merle hat der mischerbige Genotyp H/h keinen sichtbaren Effekt).
Ein weiterer Effekt bestimmter Weißscheckungs- und Merle-Genotypen besteht darin, dass sie die Funktion der Stria vascularis, einer drüsenähnlichen Zellstruktur im Innenohr, beeinträchtigen können. Die Stria vascularis ist für die Blutversorgung der Cochlea verantwortlich, und ihre Degeneration kann zu einer Beeinträchtigung der Hörfähigkeit bis hin zu Taubheit führen.
Der S-Lokus hat vier Allele. Das dominante Allel S führt zu einfarbigem Fell. Drei rezessive Allele verursachen zunehmend weiße Flecken im Fell: Irish spotting (si), piebald (sp) und extrem weißer Piebald (sw).
Bestimmte Genotypen am M-Lokus sind mit einem hohen Risiko für schädliche Auswirkungen auf die Sinnesorgane verbunden. Dabei handelt es sich um folgende Kombinationen: Mh/Mh, M/M, Mh/Ma+, Mh/Ma, M/Ma+. Daraus können Funktionseinschränkungen bis hin zum Funktionsverlust des Visus und Hörsinnes resultieren. Wenn der Merle-Faktor im homozygoten Genotyp (M/M) vererbt wird, sind die Hunde in der Regel nahezu vollständig weiß und können taub und/oder blind sein. Für weitere Informationen s. QUEN-Merkblatt Nr. 6 Hund Merle-Syndrom.
Das Harlekin-Allel ist ein Modifikator, der, in Verbindung mit der Merle-Zeichnung (Genotyp M/m), bei schwarzer Grundfarbe zur charakteristischen Harlekin-Doggen-Fellzeichnung führt. Diese Zeichnung besteht aus schwarzen Flecken auf weißem Grund. Für die Harlekin-Variante homozygote Individuen (H/H) sind nicht lebensfähig und sterben während der Embryogenese im Mutterleib.
Die Deutsche Dogge ist eine von über 80 Hunderassen, bei denen eine erhöhte Häufigkeit an angeborener Taubheit beschrieben wurde. Bei Deutschen Doggen weisen vor allem die sogenannten Harlekin-Doggen ein hohes Risiko für Taubheit auf, während andere Farbvarianten seltener betroffen sind. Den Teststatistiken der OFA ist zu entnehmen, dass 60% der getesteten Doggen Träger des Harlekin-Faktors und 52 % Träger des Piebald-Weißscheckung-Gens sind.
Psychisch:
Taube Hunde sind in ihrem Sozialverhalten eingeschränkt, da sie akustische Signale nicht oder nur eingeschränkt wahrnehmen können. Freilauf ist bei tauben Hunden nur eingeschränkt möglich.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägungsgrad
Augenerkrankungen (Entropium, Ektropium, Nickhautdrüsenvorfall (Cherry Eye))
Physisch:
Entropium
Bei Deutschen Doggen tritt ein primäres Entropium rassebedingt gehäuft auf.
Beim Entropium ist der Lidrand ganz oder teilweise nach innen gewölbt. Dieser Zustand verursacht das Wachstum der Wimpern in Richtung Augapfel (Trichiasis), übermäßiges Tränen (Epiphora), Hornhautentzündung (Keratitis) und Geschwüre (Ulzerationen). Dies kann entweder nur die Oberfläche betreffen oder das Auge ernsthaft schädigen. Für weitere Details s. QUEN-Merkblatt Nr. 11 Hund Entropium.
Ektropium
Die Deutsche Dogge ist für ein Ektropium prädisponiert und wird im Blue Book 2023 der ACVO mit einer Prävalenz von 3,9% für die Erkrankung geführt. Eine Auswertung für 2024 ergab eine Erhöhung der Prävalenz für ein Ektropium auf 6,3%.
Ektropium beschreibt das nach außen gerichtete Umstülpen oder die Eversion des unteren Augenlids. In seiner primären Form tritt es ausschließlich am unteren Augenlid auf und ist in den meisten Fällen bilateral. Besonders Rassen mit langen Augenlidern und einer Laxheit im äußeren Augenwinkel sind betroffen. Dadurch wird die Bindehaut freigelegt, Fremdkörper können sich im unteren Bindehautsack ansammeln und der Tränenfilm verteilt sich schlecht über die Hornhautoberfläche. Das kann zu einer Bindehautentzündung und einer erhöhten Muzinproduktion führen.
Je nach Schweregrad kann das Ektropium unterschiedliche Beschwerden verursachen. Diese reichen von einer einfachen Funktionsstörung, die sich durch abnormalen Tränenfluss und unregelmäßige Blinzelfrequenz zeigt, bis hin zu einem Blepharospasmus, dessen Ausprägung vom Schmerz abhängt. In den schwersten Fällen kann es zu Hornhautvaskularisierung, Pigmentierung, Hornhautgeschwüren kommen, die bei starker Hornhauttrockenheit sogar zur Perforation führen können.
Das Ektropium erfordert je nach Ausprägung eine tägliche, lebenslange medizinische Pflege. Dazu gehören Maßnahmen wie Tränenersatzflüssigkeit, lokale Antibiotika- und Glucocorticoid-Therapie sowie im Erwachsenenalter chirurgische Lidkorrekturen und Folgeeingriffe. Für weitere Details siehe QUEN-Merkblatt Nr. 32 Hund Ektropium.
Nickhautdrüsenvorfall („Cherry Eye”)
Die Studienlage zeigt, dass die Prävalenz eines Nickhautdrüsenvorfalls bei Deutschen Doggen etwa zwischen 0,3 % und 5,22 % liegt.
Ein Nickhautdrüsenvorfall bezeichnet eine Erkrankung, bei der die Tränendrüse des dritten Augenlids, der sogenannten Nickhaut, aus ihrer normalen Position hinter der Nickhaut hervortritt und sichtbar wird. Dieser Vorfall wird oft von einer Entzündung begleitet, die die Drüse betrifft und zu einer Schwellung führt. Zu sehen ist eine rötlich-follikuläre Masse, die aus dem Rand der Nickhaut hervorragt – daher auch der Beiname „Cherry Eye“ (Kirschauge). Die Entzündung der Nickhaut trägt zur Ausprägung des Vorfalls bei und kann die Funktion der Tränendrüse beeinträchtigen, was zu einer verminderten Feuchtigkeitsversorgung des Auges führen kann. Dies kann bei unbehandelten Fällen zu einer Keratoconjunctivitis sicca (KCS), auch als „trockene Augen“ bekannt, führen. KCS ist eine chronische, fortschreitende Erkrankung, die zur Erblindung des Hundes führen kann.
Zu Beginn ist ein Prolaps der Nickhaut vermutlich kaum schmerzhaft. Wird er jedoch nicht behandelt, führt es häufig zu chronischen Zuständen, Entzündungen, Infektionen und Verletzungen der Nickhautdrüse sowie zu möglichen sekundären Hornhautverletzungen.
Psychisch:
Die Irritationen des Auges durch die nach innen gerichteten Haare beim Entropium beeinträchtigen das Wohlbefinden und das Verhalten der betroffenen Hunde.
Beim Ektropium ist die Dauerexposition des Bulbus und der Bindehäute gegenüber Umwelteinflüssen mit z.T. hochgradigen Schmerzen verbunden. Ebenso führen Trockenheit, Ulzerationen und Perforationen der Hornhaut zu Schmerzen. Pflegerische Maßnahmen müssen mehrmals täglich erfolgen, was dem Tier psychischen Stress bereitet und (ebenso wie die Expositionsvermeidung des Bulbus gegenüber Umwelteinflüssen) das natürliche bzw. artgerechte Verhalten (Rennen, Spiel- und Komfortverhalten: Wälzen, Schnüffeln, Sonnenlichtexposition) stark einschränkt. Eingeschränktes Sehvermögen beeinträchtigt die Tiere ebenfalls stark in der Ausübung ihres arteigenen Verhaltens.
Die oben beschriebenen Verläufe eines Prolaps der Nickhautdrüse können zu Unbehagen und/oder Schmerzen führen.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägung
Primäre Hypothyreose
Physisch:
Eine Primäre Hypothyreose tritt besonders häufig bei mittelgroßen bis großen Rassehunden auf, darunter die Deutsche Dogge. Die Rasse weist eine genetische Prädisposition auf. In einer Studie mit insgesamt 5957 Hunden wurde bei Deutschen Doggen eine Inzidenz der Erkrankung von 3,7 % beobachtet.
Die OFA gibt für die Deutsche Dogge eine Prävalenz für Schilddrüsenerkrankungen zwischen 2 und 14% für die Jahre 1997-2025 an.
Hypothyreose ist eine endokrine Störung, die durch einen Mangel an aktiven Schilddrüsenhormonen Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) hervorgerufen wird. Dieser kann aufgrund angeborener oder erworbener Defekte der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse entstehen. In den meisten Fällen wird die Erkrankung durch eine irreversible Zerstörung der Schilddrüse verursacht. In diesen Fällen spricht man von einer primären Hypothyreose. Bei ca. der Hälfte der Fälle mit primärer Hypothyreose wird das Schilddrüsenparenchym mit Fett- oder Bindegewebe ersetzt. Die Ursache wurde bisher noch nicht geklärt (idiopathische Hypothyreose). Die anderen Fälle sind auf eine lymphozytäre oder auch autoimmune Thyreoiditis zurückzuführen. Lymphozyten, Makrophagen und Plasmazellen dringen in die Schilddrüse ein und führen zu einer fortschreitenden Zerstörung der Schilddrüsenfollikel. Die Ursache ist immunbedingt, der genaue Grund jedoch unklar. Lymphozytäre Thyreoiditis entwickelt sich langsam und eindeutige Symptome einer Hypothyreose treten erst auf, nachdem etwa 75 % des Schilddrüsengewebes zerstört wurden.
Erkrankte Hunde weisen eine Mischung aus dermatologischen und metabolischen Symptomen auf. Da die Schilddrüsenhormone den Stoffwechsel der meisten Organe regulieren, sind die metabolischen Symptome variabel, vage und selten eindeutig diagnostisch.
Deutsche Doggen mit Hypothyreose können an Gewichtszunahme bis hin zur Fettleibigkeit leiden, ohne einen übermäßigen Appetit zu zeigen. Des Weiteren treten häufig dermatologische Symptome auf. Dazu zählen Haarausfall, trockenes bzw. ungesundes Haar, Hyperpigmentierung der Haut und eine übermäßige Produktion von Hautfett (Seborrhoe). Zudem kann es zu einer bakteriellen Hautinfektion (Pyodermie) kommen.
Verschiedene weniger häufige Symptome werden ebenfalls mit Hypothyreose in Verbindung gebracht. Zu diesen zählen neurologische Störungen – Megaösophagus (erweiterte Speiseröhre), Kehlkopfparalyse, Lähmung des Gesichtsnervs, Gleichgewichtsstörungen, Muskelerkrankungen -, dilatative Kardiomyopathie, zahlreiche Beeinträchtigungen der Fortpflanzung, Augenprobleme, wie trockene Augen und Lipidablagerungen auf der Hornhaut, sowie Blutgerinnungsstörungen.
Bei älteren Hunden wird eine Erkrankung des unteren Motoneurons beobachtet, die sich zunächst durch allgemeine Schwäche äußert. Im weiteren Verlauf treten Veränderungen im Gangbild auf, wie das Schleifen der Pfoten oder ein übermäßiger Abrieb der Krallen. In schwereren Fällen kommt es zu einer Schwäche der Hinterbeine (Paraparese) oder sogar aller vier Gliedmaßen (Tetraparese). Die Hunde können in ihrer Fähigkeit, die Position ihrer Gliedmaßen wahrzunehmen, eingeschränkt sein und die Reflexe sind schwächer.
Psychisch:
Psychische Auswirkungen der Hypothyreose können Lethargie, Belastungsintoleranz und Kälteempfindlichkeit sein. Zudem kann die große Variabilität des klinischen Bildes verschiedene negative Auswirkungen auf das Verhalten und das Wohlbefinden von Deutschen Doggen haben. Die Bewegungseinschränkungen führen zu einer geringeren Aktivität und einem eingeschränkten Verhalten. Die dermatologischen Auffälligkeiten führen zu einem verminderten Wohlbefinden.
Belastungskategorie: 2
Hauterkrankungen
Ichthyose
Physisch:
Ichthyosis tritt bei reinrassigen Hunden vermehrt auf, auch bei der Deutschen Dogge. In dieser Rasse zeigt sich die Erkrankung in ihrer schwersten Form.
Die Ichthyose ist eine angeborene Hauterkrankung, bei der Defekte in den Zellen der äußeren Hautschicht (Corneozyten) auftreten. Die Erkrankung zeichnet sich durch eine übermäßige Schuppenbildung auf der gesamten Körperoberfläche aus und ist nicht heilbar – die Symptome können lediglich gelindert werden.
Die nicht-epidermolytische Ichthyose, die bei Deutschen Doggen auftritt, zeigt sich durch eine starke Verdickung der Hornschicht (Hyperkeratose) und eine verstärkte Zellbildung in den oberen Hautschichten (Hyperplasie). Dabei treten außerdem ungewöhnlich viele körnige Strukturen in der Haut (Hypergranulose) sowie kleine Bläschen (Vakuolen) und Zellauflösungen in bestimmten Hautschichten auf.
Die Ichthyose bei Deutschen Doggen zeigt sich bereits ab der Geburt mit starken Falten im Kopf- und Beinbereich. Ein Mangel an SLC27A4-Protein führt zu einer Verdickung der oberen Hautschicht, da sich die Hautzellen in den unteren Schichten schneller vermehren. Die Haut wirkt ölig, vor allem um Nase und Augen, und wird im Laufe der Zeit von einem gelben, fettigen Material bedeckt. Feine, trockene Schuppen erscheinen am gesamten Körper. Die Haut wird trocken, unelastisch und lederartig. Besonders in haarlosen Bereichen wie den Achseln und der Leistengegend zeigt sich eine stark trockene, ledrige Struktur. Mit dem Alter können sekundäre Infektionen und entzündliche Hautveränderungen auftreten, vor allem in den Falten.
Psychisch:
Die oben beschriebenen klinischen Auffälligkeiten reduzieren das Wohlbefinden der betroffenen Hunde.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägung
Erkrankungen des Verdauungstraktes (Megaösophagus, Magendilatation/ Magendrehung)
Megaösophagus
Physisch:
Bei Deutschen Doggen tritt ein Megaösophagus gehäuft auf. Sie haben mitunter die höchsten Inzidenzen. Rüden haben ein doppelt so hohes Risiko, an einem Megaösophagus zu erkranken, wie Hündinnen.
Der Megaösophagus ist eine Erkrankung der Speiseröhre, die sich durch deren diffuse Erweiterung und eine reduzierte Beweglichkeit der ösophagealen Muskulatur auszeichnet. Ein angeborener Megaösophagus (MO) entsteht durch einen Defekt des afferenten Vagusnervs. Dies führt dazu, dass die Dehnung der Speiseröhre, was normalerweise die Peristaltik auslöst, nicht erkannt wird. Bei der angeborenen idiopathischen Form des Syndroms kommt es bereits im Welpenalter zum Erbrechen von Nahrung, Wachstumsstörungen und dem Abbau der körperlichen Verfassung.
Das häufigste klinische Anzeichen für Megaösophagus, das auch bei der Deutschen Dogge beobachtet werden kann, ist Regurgitieren – das Zurückfließen von Nahrung oder Flüssigkeit aus der Speiseröhre in die Maulhöhle. Dies kann alle paar Tage bis hin zu mehrmals täglich auftreten. Betroffene Tiere leiden daher häufig unter Mangelernährung und Aspirationspneumonie. Bei der Aspirationspneumonie handelt es sich um eine Form der Lungenentzündung, die durch das Einatmen von Sekreten aus dem Maul und/oder von Mageninhalten entsteht. Es kommt oft zu übermäßigem Speichelfluss, leichter bis mäßiger Abmagerung, Husten und pulmonalen Rasselgeräuschen oder Pfeifen. Schlucken ist schwierig und schmerzhaft.
Im Breed Report der AGRIA für 2016-2021 für die Deutsche Dogge wird eine ca. 9-fach erhöhte Prävalenz für Pneumonien und/oder Erkrankungen der oberen Luftwege und ein 12-fach erhöhtes relatives Risiko für eine Aspirationspneumonie im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Rassen angegeben.
Psychisch:
Betroffene Hunde, die an Abmagerung leiden, können ihr Normalverhalten nur eingeschränkt ausleben. Komplikationen, wie eine Aspirationspneumonie, schwächen die Hunde zusätzlich und beeinträchtigen ihr Wohlbefinden.
Belastungskategorie: 3
Magendilatation/ Magendrehung (GDV – gastric dilatation and volvulus)
Physisch:
Besonders große und sehr große, tiefbrüstige Hunderassen haben ein erhöhtes Risiko für eine Magendilatation/Magendrehung. Die Deutsche Dogge hat je nach Studie unter diesen Rassen die höchste oder zweithöchste Prävalenz bei Magendilatation/Magendrehung. Bei Deutschen Doggen liegt die rassespezifische Prävalenz für GDV in verschiedenen Studien zwischen etwa 2,2 % und 14 %. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe ihres Lebens eine GDV zu entwickeln, beträgt laut einer Studie etwa 42,4 %, wobei 12,6 % daran sterben. Zudem sind bei Deutschen Doggen 18,7 % aller Todesfälle auf GDV zurückzuführen.
Im Breed Report der AGRIA für 2016-2021 für die Deutsche Dogge wird im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Rassen eine ca. 9-fach erhöhte Prävalenz und ein 25-fach erhöhtes relatives Risiko, an GDV zu erkranken, angegeben. Auch eine weitere Studie ermittelte ein signifikant erhöhtes Risiko für Deutsche Doggen, an GDV zu erkranken und daran zu versterben. Die Sterblichkeitsrate bei akuter GDV lag in einer Studie mit 306 Hunden, davon 30 Deutsche Doggen, bei 10 %. Die Inzidenz an GDV steigt bei Deutschen Doggen mit zunehmendem Alter.
GDV beschreibt die schnelle Ansammlung von Luft im Magen, wobei dieser in unterschiedlichem Ausmaß fehlpositioniert ist. Es kommt zu einem Druckanstieg im Magen, der zu einem kardiogenen Schock führen kann. Die Atmung kann erschwert werden, da der vergrößerte Magen die Bewegungen des Zwerchfells einschränkt und so das Atemvolumen verringert.
Bleibt die Erkrankung unbehandelt, kann die Blutzirkulation stark beeinträchtigt werden, was zu verschiedenen Schockzuständen führt. Zu Beginn zeigen betroffene Tiere Symptome, die einem hypovolämischen Schock ähneln, da ihr Blutvolumen in den großen Blutgefäßen eingeschränkt ist. Später kann sich ein endotoxischer Schock entwickeln, gekennzeichnet durch schwachen Puls, Fieber und rote Schleimhäute. In der fortgeschrittenen Phase kommt es zu schwerer Hypotonie, langsamem Herzschlag, kalten Extremitäten und blassen Schleimhäuten. Diese Situation ist ein lebensbedrohlicher Zustand und die Überlebensprognose hängt vom Schweregrad der Erkrankung bei der Erstuntersuchung ab.
Große und tiefbrüstige Körper, wie sie Deutsche Doggen zuchtbedingt aufweisen, haben einen großen Bauchraum, was GDV fördert. Ein Magen, der mit Nahrung gefüllt ist, dehnt das hepatogastrische Band und begünstigt so die Beweglichkeit und einen Volvulus des Magens. Eine Schädigung des hepatogastrischen Bandes kann diese Dehnung weiter fördern. Dass das Risiko für GDV mit zunehmendem Alter steigt, liegt möglicherweise an der fortschreitenden Dehnung des hepatogastrischen Bandes. Ein schlanker Körperzustand reduziert das Bauchfett, das normalerweise als Stabilisator für den Magen fungiert und einen Volvulus verhindern kann. Das Vorhandensein eines direkten Verwandten, der an GDV litt, erhöht das Risiko, dass auch der Hund selbst an GDV erkrankt.
Eine Studie beschreibt den Charakter als wesentlichen Faktor für das Risiko, an einer GDV zu erkranken. Hunde, die von ihren Besitzer*innen als nervös oder ängstlich eingestuft werden, haben ein höheres Risiko für eine Magendilatation/Magendrehung, während Hunde, die als glücklich oder entspannt eingestuft werden, ein geringeres Risiko aufweisen. Ein nervöser Charakter kann mit einem schlanken Körperbau in Verbindung stehen und ebenfalls das Risiko erhöhen. Zudem kann es zu verstärkten Magenkontraktionen und einer abnormen Magenmotilität kommen.
Eine genetische Veranlagung für GDV könnte durch die Vererbung einer bestimmten Körperform oder eines nervösen Charakters bestehen, die eine Neigung zur Magendrehung begünstigen.
Psychisch:
GDV kombiniert erhebliche Schmerzen und eine hohe Sterblichkeitsrate und führt damit zu beachtlichem Leiden bei betroffenen Hunden.
Belastungskategorie: 3
Lebenserwartung und Mortalität
Es ist bekannt, dass große Rassen eine geringere Lebenserwartung haben als kleine Hunderassen. Die mittlere Lebenserwartung der Deutschen Dogge liegt je nach Quelle zwischen ca. 6 und ca. 8 Jahren. Die Haupttodesursachen waren Herzerkrankungen, Tumorerkrankungen und gastrointestinale Erkrankungen wie GDV. Auch der Breed Report 2016-2021 der AGRIA zeigt, dass die Deutsche Dogge ein doppelt so großes Risiko für ein Versterben (oder eine Euthanasie) aufgrund von Gesundheitsproblemen hatte wie der Durchschnitt aller dort versicherten Rassen.
Spezifische Gesundheitsprobleme bei sehr großen Rassen – Beeinträchtigung der Tiere durch Riesenwuchs
Die Zucht auf exorbitante Größe (Gigantismus*) erhöht das Risiko für folgende Gesundheitsprobleme:
*Der Begriff Gigantismus kann in verschiedenen Studien unterschiedlich definiert werden. Üblicherweise wird er ab einem Körpergewicht von etwa 45 kg verwendet, doch es gibt auch Studien, die den Begriff bereits bei einem Gewicht von über 25 kg ansetzen. Wieder andere Quellen sprechen erst ab einem Gewicht von über 90 kg von Gigantismus. Diese unterschiedlichen Grenzen zeigen, dass die Definition je nach Studie und Kontext variieren kann.
Riesige Hunderassen sind aufgrund ihrer genetischen Geschichte und Zucht anfällig für gesundheitliche Probleme wie Skelettdysplasien, Herzkrankheiten, bestimmte Krebsarten und Magendrehungen. Ihre Gesundheit hängt von einer komplexen Kombination aus Genetik und Umwelt ab. Ein gutes Verständnis dieser genetischen Veranlagungen ist wichtig, um verantwortungsvolle Zucht zu fördern und das Wohlbefinden der Tiere zu verbessern.
Eine Studie zeigte, dass bei Deutschen Doggen die Phase hoher Wachstumshormon (Growth Hormone, GH)-Freisetzung auch nach Schluss der Wachstumsfugen deutlich länger dauert als bei der Vergleichsrasse Beagle. Es wird vermutet, dass dieser Unterschied auf eine verzögerte Reifung der hemmenden Wirkung von Somatostatin auf die GH-Freisetzung in der Hypophyse bei Doggen zurückzuführen sein könnte.
Das schnelle Wachstum in den ersten Lebensmonaten belastet Skelett, Sehnen, Bänder und Gelenke stark. Bei Doggen ist das Risiko für orthopädische Probleme wie Hüft- und Ellbogendysplasie sowie für Wachstumsstörungen erhöht. Diese Erkrankungen sind weit verbreitet, verursachen Schmerzen und beeinträchtigen die Mobilität, da das schnelle Wachstum die sich noch entwickelnden Gelenke stark beansprucht.
Eine Magendrehung (GDV) ist eine häufige Erkrankung und gleichzeitig die häufigste Todesursache bei Doggen. Sie ist bekannt bei Besitzern und Züchtern. Der Amerikanische Kennel Club empfiehlt Doggenbesitzern, sich über die Anzeichen einer Magendrehung zu informieren und zu wissen, was in diesem Fall zu tun ist. Viele Züchter und Besitzer ziehen eine prophylaktische Gastropexie in Betracht, um schwerwiegende Folgen einer GDV zu verhindern.
Bei der Dogge können außerdem weitere Erkrankungen auftreten, wie die Dilatative Kardiomyopathie (DCM) oder ein erhöhtes Risiko für Osteosarkome, also Knochenkrebs.
Die große Endgröße und das hohe Gewicht der Deutschen Dogge beeinflussen ihre Lebenserwartung negativ. Aufgrund der Belastung für Herz-Kreislauf-System und Gelenke leben Doggen im Durchschnitt nur etwa 7 bis 10 Jahre, was im Vergleich zu kleineren Rassen relativ kurz ist.
Für weitere Details und Referenzen zu den einzelnen Erkrankungen siehe oben.
Fazit: Eine Empfehlung zur Reduktion von Größe und Gewicht der Deutschen Dogge in der Zuchtplanung erscheint aus den oben genannten Gründen essentiell.
Tierethische Bewertung der Qualzuchtproblematik bei der Deutschen Dogge
Auf Basis der in diesem QUEN-Merkblatt genannten Fakten, welche die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von zuchtbedingten Defekten der Belastungskategorien 2-3 (mittlere bis starke Belastung) bzw. 3 (starke Belastung) auflisten, ist aus tierethischer Sicht festzustellen, dass die Weiterzucht mit betroffenen Tieren dieser Rasse als höchst problematisch einzustufen ist, da ein Züchter davon ausgehen muss, dass Tiere, die er durch seine Zucht in die Welt setzt, erheblich und andauernd Einschränkungen des Wohlbefindens und/oder Schmerzen ertragen müssen oder leiden werden. Dies ist bereits dann inakzeptabel, wenn zumindest einer der im gegenständlichen Merkblatt genannten zuchtbedingten Defekte in den Belastungskategorien 2-3 bei mindestens einem der von ihm gezüchteten Tiere in vorhersehbarer Weise eintritt, wobei „vorhersehbare“ erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann vorliegen, wenn sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen erwartbar auftreten.
6. Vererbung, Genetik, ggf. bekannte Gen-Teste, ggf. durchschnittlicher genomischer Inzuchtkoeffizient (COI) für die Rasse
Dilatative Kardiomyopathie
DCM wird bei Deutschen Doggen autosomal dominant vererbt. Bei Deutschen Doggen mit DCM wurde eine signifikante Herunterregulation von Triadin und eine Hochregulation von Calstabin2 festgestellt. Diese Moleküle sind entscheidend für das ordnungsgemäße Funktionieren von RyR2 und dem CRU.
Hüftdysplasie
Hüftgelenksdysplasie bei Deutschen Doggen ist eine multifaktorielle Erkrankung, bei der die genetische Veranlagung eine entscheidende Rolle spielt. Die Erkrankung wird als polygenetisches Merkmal beschrieben, das einen komplexen Erbgang aufweist, bei dem die phänotypische Ausprägung durch äußere Faktoren beeinflusst wird. Genetische Screening-Programme werden durch den polygenen Charakter der Hüftdysplasie sowie durch Umwelteinflüsse auf die phänotypische Ausprägung erschwert. Keine molekulardiagnostischen Tests vorhanden.
Ellenbogendysplasie
Die individuelle Veranlagung zur Entwicklung von Ellenbogendysplasie ist polygenetisch. Mehrere Gene sind beteiligt, die bei verschiedenen Rassen unterschiedlich vererbt werden. Aufgrund der komplexen Vererbungsmechanismen und des Einflusses von Umweltfaktoren auf die Ausprägung der Erkrankung ist es unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft Gentests für Ellenbogendysplasie entwickelt werden können.
Fehlende Fellpigmentierung und angeborene Taubheit
Merle (M) auf Chromosom 10 (CFA10): Das SILV-Gen produziert ein Melanozyten-Protein (Pmel17), das eine Rolle bei der Pigmentierung spielt. Eine 256 Basenpaare lange Retrotransposon-Insertion mit einem Poly-A-Schwanz verursacht die Merle-Pigmentierung. Weitere Informationen können dem Merkblatt zum Merle-Syndrom entnommen werden.
Piebald (S) auf Chromosom 20 (CFA20): Das MITF-Gen reguliert das SILV-Gen und das Tyrosinase-Gen, die für die Melaninproduktion und Melanozytenentwicklung verantwortlich sind. Zwei Mutationen upstream der M-Promotorregion des Gens führen zu den verschiedenen rezessiven Allelen von S.
Irish Spotting (si) auf Chromosom 15 (CFA15): Das KITLG-Gen (c-Kit Ligand) spielt eine Rolle bei der Melanogenese und könnte der Ursprung des Irish-Spotting-Allels von S sein.
Harlequin auf Chromosom 9 (CFA9): Ein noch unbekanntes Gen modifiziert die Wirkung von Merle und führt zu einer vollständigen Hypopigmentierung in Bereichen, die normalerweise bei Merles weiß sind.
Nickhautdrüsenvorfall (Cherry Eye)
Eine Studie fand einen genetischen Marker (FGF4L1) auf Chromosom 18 (CFA18), der mit dem Nickhautdrüsenvorfall assoziiert ist.
Ichthyose
Die Ichthyose wird autosomal-rezessiv vererbt. Mehrere genetische Varianten, die die Erkrankung auslösen, wurden in bestimmten Hunderassen identifiziert – bei der Deutschen Dogge handelt es sich um eine Variante der Region des SLC27A4-Gens. Ein deutlich ausgeprägter Peak wurde auf Chromosom 9 bei 57–58 Mb in dieser Region festgestellt. Das mutierte Transkript von SLC27A4 zeigte einen In-Frame-Verlust von 54 Basenpaaren in Exon 8, was den Verlust von 18 Aminosäuren zur Folge hatte. Es steht ein Gentest zur Verfügung.
Megaösophagus
Auf Chromosom 1 gibt es eine 2,3 Mb große Region, die mit dem kongenitalen idiopathischen Megaösophagus in Verbindung gebracht wird. Diese Region enthält 14 Einzel-Nukleotid-Varianten (SNVs), die in nicht-kodierenden Regionen liegen und somit regulatorischer Natur sein könnten.
Magendilatation/ Magendrehung
Die genetische Grundlage von Magendilatation/ Magendrehung bei Hunden, unter anderem Deutsche Doggen, zeigt Hinweise auf SNPs und strukturelle Varianten, die mit der Erkrankung in Verbindung stehen. Besonders wurden Gene wie PRKCZ, VHL und NALCN hervorgehoben, die Magentonus, Motilität und Funktionen des enterischen Nervensystems beeinflussen könnten. Die Gene DLA88, DRB1 und TLR5 werden mit einem erhöhten Risiko für Magen-Dilatation-Volvulus (GDV) bei Deutschen Doggen in Verbindung gebracht.
Weitere für die Rasse verfügbare Gentests
Centronukleäre Myopathie (CNM)
Degenerative Myelopathie (DM) Exon 2
Maligne Hyperthermie
Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA)
Die Werte für den durchschnittlichen genomischen * Inzuchtkoeffizient bei der Deutschen Dogge sind noch nicht aussagekräftig, da die getestete Anzahl zu gering ist. Es gibt keinen Standard zwischen den Laboren, der Hund ist immer nur mit dem Durchschnitt des jeweiligen Labors vergleichbar.
Grundlage einer verantwortungsvollen Zucht ist bei der sorgfältigen Diagnose des Einzeltieres nicht nur die Beurteilung des Exterieurs und der Verhaltenseigenschaften der Zuchtpartner vor dem ersten Zuchteinsatz, sondern auch die Nutzung moderner molekulargenetischer Diagnostik. Innerhalb eines Screenings sollte diese nicht nur zur Identifizierung von Merkmals- oder Anlageträgern, sondern auch zur Bestimmung des Inzuchtgrades des Einzeltieres genutzt werden. Inzwischen bieten Labore sogenannte „Matching Tools” oder „Mating Scores“ an, welche Züchter nutzen können, um geeignete Zuchtpartner zu identifizieren, wobei gleichzeitig die Verpaarung von Tieren mit gleichen risikobehafteten Anlagen verhindert werden kann. Verschiedene spezialisierte Labore bieten für Züchter entsprechende Beratungen an.
* der nach Abstammung/Ahnentafel berechnete Koeffizient ist nicht ausreichend präzise.
7. Diagnose-notwendige Untersuchungen vor Zucht oder Ausstellungen
Achtung: Invasive, das Tier belastende Untersuchungen sollten nur in begründeten Verdachtsfällen bei Zuchttieren durchgeführt werden und nicht, wenn bereits sichtbare Defekte zum Zucht- und Ausstellungsverbot führen.
Dilatative Kardiomyopathie
Die Diagnose der DCM basiert hauptsächlich auf den Ergebnissen von echokardiographischen Untersuchungen in Verbindung mit der klinischen Präsentation, röntgenologischen Befunden und elektrokardiographischen Ergebnissen. Beim Vorhofflimmern werden klinische und echokardiographische Untersuchungen vorgenommen.
Hüftgelenks- und Ellenbogendysplasie
Die am häufigsten verwendete Methode zur Diagnose der Hüftgelenksdysplasie bei Hunden ist die Röntgenuntersuchung (klassisch oder PennHIP®-Methode nach Smith). Daneben wird die Computertomographie zunehmend beliebter bei der Diagnose. Ergänzend werden jedoch Verfahren wie Provokationstests, Dehnen, Beugen und Strecken der Gliedmaßen empfohlen, um die Gelenklaxität, Schmerzen und Bewegungseinschränkungen zu beurteilen, die oft als erste Anzeichen einer Dysplasie auftreten.
Die Ellenbogendysplasie lässt sich anhand der charakteristischen Abweichung in der normalen Stellung der Pfoten und Vorderbeine feststellen. Bildgebende Verfahren wie Röntgen und Computertomographie bieten eine präzise Darstellung der knöchernen Strukturen der Gelenke. Zudem erlaubt die Computertomographie nicht nur die Diagnose, sondern auch die Überwachung des Fortschreitens der Ellenbogendysplasie.
Osteochondrose/Osteochondrosis dissecans
Die Diagnose der OCD basiert hauptsächlich auf den Ergebnissen von röntgenologischen Befunden, CT- oder MRT-Untersuchungen und Ultraschall. Auch eine Arthroskopie oder eine Arthrographie mit Kontrastmittel kann für eine Diagnose herangezogen werden.
Osteosarkom
Die Diagnose eines Osteosarkoms erfolgt bei Verdacht in der Regel durch fortgeschrittene bildgebende Verfahren wie CT und MRT zur Beurteilung der Läsionen, gefolgt von einer Biopsie und histopathologischen Analyse für eine endgültige Bestätigung.
Cervikale Spondylomyelopathie
Die Diagnose der zervikalen Spondylomyelopathie umfasst eine bildgebende Untersuchung der zervikalen Wirbelsäule. Dazu werden grundlegende Röntgenaufnahmen, Myelographie, CT und MRT eingesetzt.
Fehlende Fellpigmentierung und angeborene Taubheit
Verhaltenstests zur Taubheitsdiagnose sind unzuverlässig. Eine objektive Diagnose erfordert elektrodiagnostische Tests, meist den BAER – Test (Hirnstammauditive evozierte Reaktionen).
Augenerkrankungen
Ektropium: Die Ausprägung des Merkmals ist durch äußerliche Betrachtung und durch eine ophthalmologische Untersuchung zu diagnostizieren. Hunde mit Ektropium haben in der Regel einen schleimigen Ausfluss im Auge, eine Rötung der freiliegenden Bindehaut und eine verminderte Tränenproduktion. Letzteres kann beim Tierarzt durch einen Schirmer-Tränen-Test festgestellt werden. Durch die Verwendung eines Transilluminators kann dieser auch die Eversion des Palpebralrands bestätigen.
Entropium: Hinweise auf ein vorliegendes Entropium geben Anamnese, klinische Anzeichen wie Blepharospasmus und Epiphora sowie die Rasse. Die Ausprägung des Merkmals ist durch äußerliche Betrachtung und durch eine ophthalmologische Untersuchung zu diagnostizieren.
Nickhautdrüsenvorfall (Cherry Eye): Inspektion des Auges und opthalmologische Untersuchung.
Primäre Hypothyreose
Die Diagnose der Hypothyreose basiert hauptsächlich auf der Beurteilung der Basalwerte von Schilddrüsenhormonen, dem endogenen Hund-TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) und dem Nachweis von TgAA (Thyreoglobulin-Autoantikörpern).
Zirkulierende Thyreoglobulin-Autoantikörper (TgAA) sind ein hilfreiches Indiz für das Vorliegen einer lymphozytären Thyreoiditis. Jedoch ist davon auszugehen, dass sich eine TgAA-positive zu einer TgAA-negativen Hypothyreose entwickelt.
Hauterkrankungen
Die Diagnose von Ichthyosis bei Hunden wird anhand klinischer Symptome wie Hautfalten und starkem Schuppenbefall der Haut sowie durch histopathologische Untersuchungen gestellt. Hautproben von betroffenen Hunden zeigen charakteristische Veränderungen, die mit speziellen Färbetechniken und Elektronenmikroskopie weiter analysiert werden.
Megaösophagus
Röntgenaufnahmen ohne Kontrastmittel sind für die Diagnose der meisten Megaösophagus-Fälle ausreichend. In einigen Fällen sind Kontrastaufnahmen oder eine Endoskopie notwendig, um die Diagnose zu bestätigen und mögliche Ursachen wie Ösophagitis auszuschließen.
Magendilatation/Magendrehung
Die Diagnose eines Magen-Dilatation-Volvulus erfolgt häufig auf Basis der Anamnese, der klinischen Befunde und der körperlichen Untersuchung. Zusätzlich werden röntgenologische Aufnahmen angefertigt. Bei einer Magendrehung handelt es sich um einen medizinischen Notfall, der sofortiger tierärztlicher Hilfe bedarf.
8. Aus tierschutzfachlicher Sicht notwendige oder mögliche Anordnungen
Entscheidungen über Zucht- oder Ausstellungsverbote sollten im Zusammenhang mit der Belastungskategorie (BK) getroffen werden. Ausschlaggebend für ein Zuchtverbot kann je nach Ausprägung und Befund der schwerste, d.h. das Tier am meisten beeinträchtigende Befund und dessen Einordnung in eine der Belastungskategorien (BK) sein, oder auch die Zusammenhangsbeurteilung, wenn viele einzelne zuchtbedingte Defekte oder rassetypische Prädispositionen vorliegen. Berücksichtigt werden sollte ggf. auch der individuelle genomische Inzuchtkoeffizient eines Tieres und die Eigenschaft als Trägertier für Risiko-Gene.
Generell sollte auch bei der Zucht von Deutschen Doggen beachtet werden:
Neben zu beachtenden äußerlichen, anatomischen und funktionellen Merkmalen sowie des Verhaltens beider Zuchtpartner, sollten die Möglichkeiten zuchthygienischer Beratung auf molekulargenetischer Ebene genutzt werden und insbesondere der genetische Inzuchtkoeffizient, der Heterozygotiewert und die Dog Leukocyte Antigene (DLA) für die Rasse bestimmt werden. In zunehmendem Maß können auch sogenannte Matching Tools/Scores die Auswahl geeigneter Zuchtpartner erleichtern.
a) notwendig erscheinende Anordnungen
Zuchtverbot gem. § 11b TierSchG für Tiere mit vererblichen/zuchtbedingten Defekten, insbesondere mit
- Veränderungen des Skelettsystems: Kopf, Wirbelsäule, Hüfte, Becken, Schulter und Ellenbogen
- Osteosarkom
- Taubheit (angeboren) in Zusammenhang mit bestimmten Fellfarben
- Magendilatation-Volvulus (Magentorsion) in der Historie
- Dilatative Kardiomyopathie
- Augenerkrankungen: Ektropium, Entropium
- Hauterkrankungen: Ichthyose
Ausstellungsverbot gem. § 10 TierSchHuV
- Veränderungen des Skelettsystems: Kopf, Wirbelsäule, Hüfte, Becken, Schulter und Ellenbogen
- Osteosarkom
- angeborene Taubheit in Zusammenhang mit bestimmten Fellfarben
- Dilatierende Kardiomyopathie
- Augenerkrankungen: Ektropium, Entropium
- Hauterkrankungen: Ichthyose
b) mögliche Anordnungen
- Anordnung zur dauerhaften chirurgischen Unfruchtbarmachung (Sterilisation/ Kastration) gemäß § 11b (2) TierSchG
- Anordnung von Gen-Testen zur Bestimmung des genomischen Inzuchtkoeffizienten und Heterozygotie-Wertes beider ggf. zur Zucht vorgesehener Tiere
- Nutzung zuchthygienischer Beratung und ggf. so genannter Matching Tools zur Vermeidung ungeeigneter Verpaarungen.
c) Anfragen und Anordnungen (im Rahmen einer Gefahrerforschungsmaßnahme) vor Erteilung einer Zuchtgenehmigung:
- Zuchtverband/Verein
- Züchter
- Populationsgröße der Rasse im Verein/Verband
- Derzeit gültiger Rassenstandard und Zuchtordnung
- Forderungen im Standard / Anatomische Merkmale, die für Krankheiten prädisponieren
- Genomischer (nicht berechneter) Inzuchtkoeffizient des Tieres / der Rasse
- Diversität (HET, DLA)
- Durchschnittlich erreichtes Lebensalter
- Häufigste Todesursache
- Durchschnittliche Wurfgröße
- Welpensterblichkeit
- Anzahl tierärztlicher Interventionen zur Geburtshilfe / Kaiserschnitte insgesamt
Untersuchungen
- freiwillig durchzuführende Untersuchungen
- verpflichtend vor Zuchtverwendung durchzuführende Untersuchungen
Gen-Teste (welche sind verfügbar und für die Rasse verifiziert?)
- freiwillig durchgeführte Gen-Teste
- verpflichtend vor Zuchtverwendung durchzuführende Gen-Teste
Bitte beachten:
Maßnahmen der zuständigen Behörde müssen erkennbar geeignet sein, auch in die Zukunft wirkend Schaden von dem betroffenen Tier und/oder dessen Nachzucht abzuwenden. Es handelt sich im Hinblick auf Art und Bearbeitungstiefe von Anordnungen und Zucht- oder Ausstellungsverboten immer um Einzelfallentscheidungen im Ermessen der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen Normen und der vor Ort vorgefundenen Umstände.
9. Allgemeine tierschutzrechtliche Bewertung
a) Deutschland
Aus rechtlicher Sicht sind Hunde mit den oben beschriebenen Defekten/ Syndromen in Deutschland gemäß §11b TierSchG als Qualzucht einzuordnen.
Begründung:
Gem. § 11b TierSchG ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht bei der Nachzucht oder den Nachkommen u.a.
- erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 1 TierSchG) oder
- mit Leiden verbundene erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 2 a) TierSchG) oder
- die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt (§ 11b Abs. 1 Nr. 2 c) TierSchG).
Schmerz definiert man beim Tier als unangenehme Sinneswahrnehmung, verursacht durch tatsächliche oder potentielle Verletzung, die motorische oder vegetative Reaktionen auslöst, in einem erlernten Vermeidungsverhalten resultiert und potentiell spezifische Verhaltensweisen verändern kann (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, TierSchG, Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 12 mwN; grds. auch Lorz/Metzger TierSchG 7. Aufl. § 1 Rn. 20).
Leiden sind alle nicht bereits vom Begriff des Schmerzes umfassten Beeinträchtigungen im Wohlbefinden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeitspanne fortdauern (Hirt/Maisack/Moritz/Felde Tierschutzgesetz Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 19 mwN.; Lorz/Metzger, TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 33 mwN). Auch Leiden können physisch wie psychisch beeinträchtigen; insbesondere Angst wird in der Kommentierung und Rechtsprechung als Leiden eingestuft (Hirt/Maisack/Moritz/Felde § 1 TierSchG Rn. 24 mwN; Lorz/Metzger § 1 TierSchG Rn. 37).
Ein Schaden liegt vor, wenn der körperliche oder seelische Zustand, in welchem ein Tier sich befindet, vorübergehend oder dauernd zum Schlechteren hin verändert wird (Hirt/Maisack/Moritz/Felde TierSchG Komm. 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 27 mwN; Lorz/Metzger TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 52 mwN), wobei völlig geringfügige Beeinträchtigungen, basierend auf körperlicher oder psychischer Grundlage, außer Betracht bleiben. „Der Sollzustand des Tieres beurteilt sich an Tieren der gleichen Art. Das Fehlen von Körperteilen wird dabei in der Kommentarliteratur regelmäßig als Schaden bewertet“ (VG Hamburg Beschl. v. 4.4.2018, 11 E 1067/18 Rn. 47, so auch Lorz/Metzger TierSchG Komm. § 1 Rn. 52).
Züchterische Erkenntnisse gem. § 11b Abs. 1 TierSchG liegen vor, wenn aufgrund allgemein zugänglicher Quellen (insbes. Stellungnahmen von Zuchtverbänden, Fachzeitschriften, -büchern und tierärztlichen Gutachten sowie dem sog. Qualzuchtgutachten des BMEL) bestimmte Erfahrungen mit der Zucht bestimmter Tierrassen bestehen, die sich wegen ihrer Übereinstimmung zu annähernd gesicherten Erkenntnissen verdichten (Lorz/Metzger, Kommentar zum TierSchG § 11b TierSchG Rn. 11).
Die Zucht von Doggen erfüllt bei Vorliegen der oben beschriebenen Defekte den Tatbestand der Qualzucht. Dies ergibt sich aus den unter Ziffer 5 im Detail erläuterten Schäden, Schmerzen und Leiden, insbesondere durch:
- Schäden an Wirbelsäule, Spondylomyelopathie (Wobbler) und damit verbundene Schmerzen und Leiden
- Schäden an Ellenbogen und Schulter und damit verbundene Schmerzen und Leiden
- Schäden an den Hüftgelenken (Hüftdysplasien) und damit verbundene Schmerzen und Leiden
- Taubheit und damit verbundene Schmerzen, Leiden oder Schäden
- Augenerkrankungen und damit verbundene Schmerzen, Leiden oder Schäden
- primäre Hypothyreose
- Hauterkrankungen und damit verbundene Schmerzen, Leiden oder Schäden
- Erkrankungen des Verdauungstraktes und damit verbundene Schmerzen, Leiden oder Schäden
Die v.a. mit der überdurchschnittlichen Körpergröße der Dogge einhergehenden Änderungen der anatomischen und physiologischen Verhältnisse sowie die damit zusammenhängenden Begleit- und Folgeerkrankungen (siehe im Detail Ziff. 5) führen zu Beeinträchtigungen wesentlicher Lebensbereiche wie Bewegung und Motorik (Laufen, Springen, Klettern), Interaktion und Spiel mit Artgenossen sowie der allgemeinen Belastbarkeit und somit zu einer erheblichen Einschränkung von arttypischen Verhaltensweisen der betroffenen Hunde. Dies führt zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und somit zu Leiden i.S.v. § 11b TierSchG bei den entsprechenden Tieren (Hirt in: Hirt/Maisack/Moritz/Felde TierSchG § 1, Rn. 20,22).
Tiere mit dem sog. Merle-Syndrom oder einer Hüftgelenksdysplasie (HD) werden darüber hinaus bereits gemäß dem sog. Qualzuchtgutachten (2000) als Qualzucht gem. § 11b TierSchG klassifiziert (vgl. Qualzuchtgutachten, S. 23f. sowie S. 31f.).
Das Verbot nach § 11b TierSchG gilt unabhängig von der subjektiven Tatseite, also unabhängig davon, ob der Züchter selbst die Möglichkeit der schädigenden Folgen erkannt hat oder hätte erkennen müssen. Wegen dieses objektiven Sorgfaltsmaßstabes kann der Züchter sich nicht auf fehlende subjektive Kenntnisse oder Erfahrungen berufen, wenn man die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen von einem sorgfältigen Züchter der jeweiligen Tierart erwarten kann (vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, Kommentar, § 11b TierSchG Rn. 6).
Vorhersehbar sind erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann, wenn ungewiss ist, ob sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen auftreten (vgl. Goetschel in Kluge § 11b Rn. 14; vgl. im Ergebnis auch Lorz/Metzger TierSchG 7. Aufl. 2019 § 11b Rn. 14).
b) Österreich
Hunde mit den o. beschriebenen Defekten/ Syndromen sind in Österreich gemäß §5 TSchG als Qualzucht einzuordnen
Gegen § 5 des österreichischen TSchG verstößt insbesondere, wer „Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen“.
- Bewegungsanomalien
- Lahmheiten bzw. schmerzhafte Beeinträchtigungen der Bewegung (z.B. als Folge von chronisch degenerativen Gelenkserkrankungen im Zusammenhang mit extremen Körperformen (Riesenwuchs) (HD, ED, OCD))
- Entzündungen der Haut (auch als Folge loser Kopfhaut oder Hängelefzen)
- Einschränkung physiologischer Funktionen durch Entzündungen oder Missbildungen der Augen bzw. ihrer Anhangsgebilde
- Blindheit
- Taubheit
- neurologische Symptome oder Funktionsverlust von Sinnesorganen
Durch die bei der Aufzählung möglicher Defekte gewählte Formulierung “insbesondere” gehören auch Herzerkrankungen bei den Nachkommen zu den klinischen Symptomen, die nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten und damit unter § 5 Abs. 1 TSchG fallen.
Die Verkürzung der Lebenserwartung ist vom Begriff der wesentlichen Beeinträchtigung physiologischer Lebensläufe erfasst.
c) Schweiz
Wer mit einem Tier züchten will, das ein Merkmal oder Symptom aufweist, das im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu einer mittleren oder starken Belastung führen kann, muss vorgängig eine Belastungsbeurteilung vornehmen lassen. Bei der Belastungsbeurteilung werden nur erblich bedingte Belastungen berücksichtigt (vgl. Art. 5 Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten [TSchZV]). Hunde mit Defekten, die der Belastungskategorie 3 zuzuordnen sind, unterliegen gemäß Art. 9 TSchZV einem Zuchtverbot. Ebenso ist es verboten, mit Tieren zu züchten, wenn das Zuchtziel bei den Nachkommen eine Belastung der Kategorie 3 zur Folge hat.
Mit Tieren der Belastungskategorie 2 darf gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt (Art. 6 TSchZV). Anhang 2 der TSchZV nennt Merkmale und Symptome, die im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu mittleren oder starken Belastungen führen können. Skelettanomalien, degenerative Gelenkveränderungen, Koordinations- oder Bewegungsstörungen, Fehlfunktionen des Hörapparates, Fehlfunktionen der Augen sowie Katarakt, die Progressive Retinaatrophie (PRA), Ektropium und Entropium werden ausdrücklich erwähnt. Zudem werden gemäß Art. 10 TSchZV einzelne Zuchtformen ausdrücklich verboten. In den übrigen Fällen wird ein Zuchtverbot jedoch nur im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung ausgesprochen. Tiere, die aufgrund unzulässiger Zuchtziele gezüchtet wurden, dürfen nicht ausgestellt werden (Art. 30a Abs. 4 Bst. b TSchV).
d) Niederlande
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” des Tierhalter-Dekrets verboten, mit Haustieren in einer Weise zu züchten, die dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Elterntiere oder ihrer Nachkommen abträglich ist.
In jedem Fall muss die Zucht so weit wie möglich verhindern, dass
- schwerwiegende Erbfehler und Krankheiten an die Nachkommen weitergegeben werden oder bei ihnen auftreten können;
- äußere Merkmale an die Nachkommen weitergegeben werden oder sich bei ihnen entwickeln können, die schädliche Folgen für das Wohlbefinden oder die Gesundheit der Tiere haben.
Folgende Erbkrankheiten oder Anomalien gemäß Artikel 3.4. sind bei der Deutschen Dogge verwirklicht: Herzerkrankungen, Erkrankungen des Auges, Erkrankungen des Bewegungsapparates, Erkrankungen des Verdauungstraktes, Hauterkrankungen
Es können u.a. folgende schädliche äußere Merkmale an die Nachkommen von Deutschen Doggen weitergegeben werden: Riesenwuchs (Gigantismus).
Ausführliche rechtliche Bewertungen und/ oder Gutachten können, soweit schon vorhanden, auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden.
10. Relevante Rechtsprechung
- Deutschland: Nicht bekannt.
- Österreich: Landesverwaltungsgericht Tirol, Straferkenntnis vom 17.04.2028, LVwG-2017/46/0237-4
- Schweiz: Nicht bekannt.
- Niederlande: Nicht bekannt.
11. Anordnungsbeispiel vorhanden?
Nein.
Anordnungsbeispiele werden ausschließlich auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt.
12. Zuwendungen und Förderungen
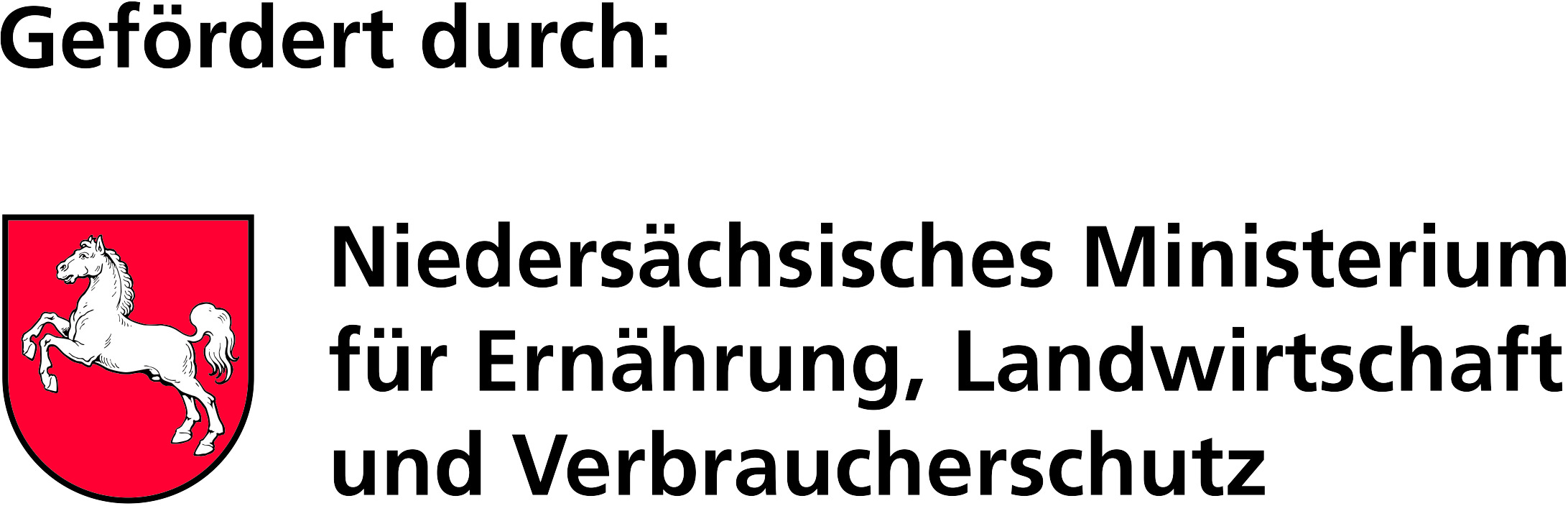
13. Literaturverzeichnis/ Referenzen/ Links
An dieser Stelle wird nur eine Auswahl an Quellen zu den oben beschriebenen Defekten und ggf. allgemeine Literatur zu zuchtbedingten Defekten bei Hunden angegeben. Umfangreichere Literaturlisten zum wissenschaftlichen Hintergrund werden auf Anfrage von Veterinärämtern ausschließlich an diese versendet.
Hinweis: Die Beschreibung von mit dem Merkmal verbundenen Gesundheitsproblemen, für die bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, erfolgen vor dem Hintergrund entsprechender Erfahrungen der Experten und Expertinnen aus der tierärztlichen Praxis, und/oder universitären Einrichtungen, sowie öffentlich frei einsehbaren Datenbanken oder Veröffentlichungen von Tier-Versicherungen und entstammen daher unterschiedlichen Evidenzklassen.
Da Zucht und Ausstellungswesen heutzutage international sind, beziehen sich die Angaben in der Regel nicht nur auf Prävalenzen von Defekten oder Merkmalen in einzelnen Verbänden, Vereinen oder Ländern.
Quellen:
AGRIA Pet Insurance Sweden. (2021). Breed Report Great Dane_VEC 2016-2021.
Armstrong, J., da Costa, R. c., & Martin-Vaquero, P. (2014). Cervical Vertebral Trabecular Bone Mineral Density in Great Danes With and Without Osseous-Associated Cervical Spondylomyelopathy. Journal of Veterinary Internal Medicine, 28(6), 1799–1804. https://doi.org/10.1111/jvim.12444
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). (2015). Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/747/de
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). (2005). Gutachten zur Auslegung von Paragraf 11b des Tierschutzgesetzes (Qualzuchtgutachten). https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Tierschutz/Gutachten-Leitlinien/Qualzucht.html
Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists, (ACVO). (2024). Ocular Disorders Report Great Dane 2024. https://ofa.org/chic-programs/browse-by-breed/?breed=GD
Glickman, L. T., Glickman, N. W., Schellenberg, D. B., Raghavan, M., & Lee, T. L. (2000). Incidence of and breed-related risk factors for gastric dilatation-volvulus in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 216(1), 40–45. https://doi.org/10.2460/javma.2000.216.40
Hale, F. A. (2021). Dental and Oral Health for the Brachycephalic Companion Animal . In Health and Welfare of Brachycephalic (Flat-faced) Companion Animals (1., S. 235–250). Taylor and Francis Group. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429263231-14/dental-oral-health-brachycephalic-companion-animal-fraser-hale
Hirt, A., Maisack, C., Moritz, J., & Felde, B. (2023). Tierschutzgesetz: Mit TierSchHundeV, TierSchNutztV, TierSchVersV, TierSchTrV, EU-Tiertransport-VO, TierSchlV, EU-Tierschlacht-VO, TierErzHaVerbG: Kommentar (4. Auflage). Verlag Franz Vahlen.
Kluge, H.-G. (Hrsg.). (2002). Tierschutzgesetz: Kommentar (1. Aufl). Kohlhammer.
Lewis, D. G. (1989). Cervical spondylomyelopathy (‘wobbler’ syndrome) in the dog: A study based on 224 cases. Journal of Small Animal Practice, 30(12), 657–665. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.1989.tb01909.x
Lorz, A., & Metzger, E. (Hrsg.). (2019). Tierschutzgesetz: Mit Allgemeiner Verwaltungsvorschrift, Art. 20a GG sowie zugehörigen Gesetzen, Rechtsverordnungen und Rechtsakten der Europäischen Union: Kommentar (7. Auflage). C.H. Beck.
Mackenzie, G., Barnhart, M., Kennedy, S., DeHoff, W., & Schertel, E. (2010). A Retrospective Study of Factors Influencing Survival Following Surgery for Gastric Dilatation-Volvulus Syndrome in 306 Dogs. Journal of the American Animal Hospital Association, 46(2), 97–102. https://doi.org/10.5326/0460097
Martin, M. W. S., Stafford Johnson, M. J., Strehlau, G., & King, J. N. (2010). Canine dilated cardiomyopathy: A retrospective study of prognostic findings in 367 clinical cases. Journal of Small Animal Practice, 51(8), 428–436. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2010.00966.x
Martin-Vaquero, P., & Da Costa, R. C. (2015). Body conformation in Great Danes with and without clinical signs of cervical spondylomyelopathy. The Veterinary Journal, 203(2), 219–222. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2014.12.003
Meurs, K. M., Miller, M. W., & Wright, N. A. (2001). Clinical features of dilated cardiomyopathy in Great Danes and results of a pedigree analysis: 17 cases (1990–2000). Journal of the American Veterinary Medical Association, 218(5), 729–732. https://doi.org/10.2460/javma.2001.218.729
Monnet, E., Orton, E. C., Salman, M., & Boon, J. (1995). Idiopathic Dilated Cardiomyopathy in Dogs: Survival and Prognostic Indicators. Journal of Veterinary Internal Medicine, 9(1), 12–17. https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.1995.tb03266.x
Nagella Naveen. (2024). Studies on hypothyroidism in dogs and its therapeutic management [Masterthesis, University Gannavaram]. https://www.researchgate.net/publication/382939656_STUDIES_ON_HYPOTHYROIDISM_IN_DOGS_AND_ITS_THERAPEUTIC_MANAGEMENT
Niederländischer Staatssekretär für Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovation vom 19. Oktober 2012, Nr. 291872, Direktion für Gesetzgebung und Rechtsfragen. (2024). Niederländisches Tierhalter-Dekret. Tierhalter Dekret. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2024-07-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel3.4
O’Neill, D. G., Case, J., Boag, A. K., Church, D. B., McGreevy, P. D., Thomson, P. C., & Brodbelt, D. C. (2017). Gastric dilation‐volvulus in dogs attending UK emergency‐care veterinary practices: Prevalence, risk factors and survival. Journal of Small Animal Practice, 58(11), 629–638. https://doi.org/10.1111/jsap.12723
Orthopedic Foundation for Animals (OFA). (o.A.). Examining Elbow Dysplasia. https://ofa.org/wp-content/uploads/2021/05/elbowarticle.pdf
Pirker, A., Staffler, C., & Dupres, G. (2015). Mortality rates of dogs with acute gastric dilatation- volvulus syndrome presented at the University of Veterinary Medicine Vienna 2006–201. Wiener Tierärztliche Monatsschrift. https://www.wtm.at/explorer/WTM/Archiv/2015/2015_WTM_56/WTM_05062015_Artikel_3_Art.1425.pdf
Schweizerischer Bundesrat. (2024). Tierschutzverordnung (TSchV) Schweiz. FedLex. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/de
Tarducci, A., Borgarelli, M., Zanatta, R., & Cagnasso, A. (2003). Asymptomatic Dilated Cardiomyopathy in Great Danes: Clinical, Electrocardiographic, Echocardiographic and Echo-Doppler Features. Veterinary Research Communications, 27, 799–802. https://doi.org/10.1023/B:VERC.0000014275.18697.18
Dieses Merkblatt wurde durch die QUEN gGmbH unter den Bedingungen der „Creative Commons – Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ – Lizenz, in Version 4.0, abgekürzt „CC BY-NC-SA 4,0“, veröffentlicht. Es darf entsprechend dieser weiterverwendet werden, Eine Kopie der Lizenz ist unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ einsehbar. Für eine von den Bedingungen abweichende Nutzung wird die Zustimmung des Rechteinhabers benötigt.
Sie können diese Seite hier in eine PDF-Datei umwandeln:







