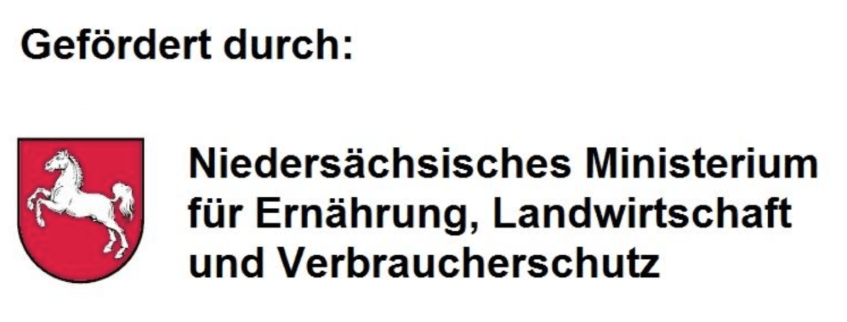Tierart: Hund
Rasse: Cavalier King Charles Spaniel
QUEN-Merkblatt Nr. 34
Bearbeitungsstand: 30.06.2025
Tierart: Hund
Rasse: Cavalier King Charles Spaniel
QUEN-Merkblatt Nr. 34
Bearbeitungsstand: 30.06.2025
1. Beschreibung der Tiere
FCI Rassestandard* CKCS Nr. 136
Historische Entwicklung:
Die ursprüngliche Form des King Charles Spaniels wurde durch die Einkreuzung kleinerer, kurznasiger Rassen verändert. Dies führte zu einer kompakteren Statur mit deutlich runderen Köpfen – eine Variante, die auch als English Toy Spaniel bekannt ist. Ab 1926 begann jedoch eine gezielte Rückzüchtung, um die ursprünglichen Merkmale wiederherzustellen. Dieser Prozess mündete 1945 in der offiziellen Anerkennung einer neuen Rasse: der Cavalier King Charles Spaniels. Diese Hunde sind etwas größer und besitzen eine längere Nase als ihre engeren Verwandten.
Heute existieren beide Rassen parallel, jeweils mit einem eigenen FCI-Standard.
Äußeres Erscheinungsbild und laut Standard geforderte, ggf. kritisch zu sehende Merkmale:
1. King Charles Spaniel (KCS) (Rassestandard Nr. 128)
Schädel: Im Verhältnis zur Körpergröße mäβig groβ, gut gewölbt und über den Augen gut ausgefüllt. Stopp: Zwischen dem Schädel und der Nase gut ausgeprägt. Gesichtsschädel: Nase sehr kurz und in Richtung Schädel aufgeworfen. Fang: Quadratisch, breit und tief, gut aufgeworfen. Kiefer/Zähne: Das Gebiss sollte einen leichten Vorbiss haben. Augen: Ziemlich groß und dunkel, weit auseinanderliegend. Die Augenlider stehen absolut rechtwinklig zur Gesichtsachse. Rücken: Gerade und kurz. Natürlicher kurzer Schwanz (Stummelrute) und Knickrute werden toleriert. Gewicht: 3,6 kg bis 6,3 kg.
Obwohl die bei beiden Rassen in unterschiedlichem Ausmaß vorhandene Brachycephalie als ursächlich für die Chiari Malformation und ggf. Syringomyelie angesehen werden muss, wird für den King Charles Spaniel/English Toy Spaniel ggf. zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes Merkblatt erstellt.
2. Cavalier King Charles Spaniel (CKCS)
Schädel zwischen den Ohren flach. Stop: Flach. Fang: Länge des Fangs von Stop bis Nasenspitze ungefähr 3,8 cm, Kiefer/Zähne: Kräftige Kiefer mit einem perfekten, regelmäβigen und vollständigen Scherengebiss, wobei die obere Schneidezahnreihe ohne Zwischenraum über die untere greift und die Zähne senkrecht im Kiefer stehen. Gewicht: 5,5 bis ca. 8 kg.
Kritische Punkte in den Zuchtordnungen und Konsequenzen daraus:
Für den Cavalier King Charles Spaniel gibt es in Deutschland drei Rassehundevereine allein innerhalb des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH). Laut Welpenstatistik des VDH wurden im Jahr 2023 in diesen Vereinen zusammen 782 Cavalier King Charles Spaniel gemeldet.
Zur Zuchttauglichkeit wird von den Hunden lediglich eine Untersuchung auf das Freisein von einer Patellaluxation und Herzklappenfehlern gefordert. Eine Untersuchung auf das Vorliegen einer Chiari-like Malformation wird weder empfohlen noch gefordert. Allerdings werden in § 19 der Zuchtordnung des “Cavalier-King-Charles-Spaniel Club Deutschland” (CCD e.V.) Maßnahmen “Zur Bekämpfung der Syringomyelie SM (Arnold Chiari Syndrom)” vorgestellt, wobei “bei Vorkommen von belasteten Ahnen neben den Original-Ahnentafeln der Welpen noch eine ‘Info-Ahnentafel’ erstellt wird, in der die Anlagenträger (Eltern, Großeltern, Ur-Großeltern etc.) und die Merkmalsträger dieser Erkrankung gekennzeichnet sind. Diese Info-Ahnentafel erhält je 1x der Züchter und die Zuchtwarte des CCD e.V.” – nicht die Welpenkäufer.
Die Hypoplasie des Hinterhauptbeins mit Obstruktion des Foramen magnum und sekundärer Syringomyelie (SM) ist jedoch eine häufige Erkrankung des Cavalier King Charles Spaniel (CKCS). Zuchtrichtlinien zur Verringerung der Häufigkeit von Mitralklappenerkrankungen haben bei gleichzeitigem Verzicht auf verpflichtende Untersuchungen zum Vorliegen einer Chiari-like Malformation (Syringomyelie) den Genpool unter Druck gesetzt.
*Rassestandards und Zuchtordnungen haben im Gegensatz zu TierSchG und TierSchHuV keine rechtliche Bindungswirkung.
2.1 Bild 1

Cavalier King Charles Spaniel.
Foto: QUEN-Archiv
2.1 Bild 2

Cavalier King Charles Spaniel.
Foto: iStock
3. In der Rasse häufig vorkommende Probleme/Syndrome
Von mehreren in dieser Rasse vorkommenden Gesundheitsproblemen und möglichen Erkrankungen werden an dieser Stelle nur die wichtigsten in der Rasse auftretenden Defekte aufgeführt.
Beim Cavalier King Charles Spaniel sind folgende erblich bedingte Defekte sowie gehäuft auftretende Gesundheitsprobleme und Dispositionen bekannt:
(Bitte beachten Sie auch die bereits vorhandenen Merkblätter zu einzelnen Defekten, insbesondere zur Brachycephalie.)
- Brachycephalie
- BOAS (Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom)
- Chiari-ähnliche Malformation/Syringomyelie
- Mitralklappenerkrankungen
- Augenerkrankungen
- Kongenitale Keratoconjunctivitis sicca und Ichthyosiforme Dermatose (CKCSID) – Dry Eye Curly Coat Syndrom
- Chondrodystrophie und Chondrodysplasie inkl. Bandscheibenerkrankungen
- Degenerative Myelopathie
- Primary secretory otitis media (PSOM)
- Zahnerkrankungen und Erkrankungen des Zahnhalteapparats
- Episodic Falling Syndrome
4. Weitere ggf. gehäuft auftretende Probleme
In der veterinärmedizinischen Fachliteratur finden sich neben den unter Punkt 3 angegebenen rassetypischen Defekten Hinweise zum Vorkommen folgender Probleme, die nachfolgend nicht weiter ausgeführt werden, da noch keine abschließenden Schlussfolgerungen aus den bekannt gewordenen Prävalenzen gezogen werden können und durch Züchter, Zuchtvereine und -verbände keine unter wissenschaftlichen Kautelen erhobenen Prävalenzen angegeben werden. Für diese Fälle ist jedoch die folgende Aussage von Hale (2021) zutreffend: “The absence of evidence is not the evidence of absence”.
- Diabetes mellitus
- Urolithiasis
- Exokrine Pankreasinsuffizienz
- Lebererkrankungen
- Patellaluxation
- Pyometra
- Dystokie
- Verschluss der Femoralarterie
- Orofaziale Spalten
- Riesenplättchen-Syndrom und Thrombozytopenie
- Analbeutelkarzinom
- Pneumocystis-Pneumonie/Immunglobulinmangel
- Kiefergelenksdysplasie
- Chronische Nierenerkrankungen
- Pankreatitis
- Idiopathische Epilepsie
- Corneale Plattenepithelkarzinome
- Duchenne Muskeldystrophie (DMD-C)
- Hüftdysplasie
5. Symptomatik und Krankheitswert einiger Defekte: Bedeutung/Auswirkungen des Defektes auf das physische/ psychische Wohlbefinden (Belastung) des Einzeltieres u. Einordnung in Belastungskategorie∗
∗ Die einzelnen zuchtbedingten Defekte werden je nach Ausprägungsgrad unterschiedlichen Belastungskategorien (BK) zugeordnet. Die Gesamt-Belastungskategorie richtet sich dabei nach dem jeweils schwersten am Einzeltier festgestellten Defekt. Das BK-System, das als Weiterentwicklung des schweizerischen Modells konzipiert ist, befindet sich noch im Aufbau. Daher sind die hier angegebenen BK-Werte als vorläufig zu betrachten. Dies vor allen Dingen deshalb, weil sich im deutschen Tierschutzgesetz keine justiziable Grundlage zur Einteilung in Belastungskategorien findet. Im Gegensatz zur Schweiz werden in den gesetzlichen Normen in Deutschland Schmerzen, Leiden oder Schäden nicht quantifiziert oder ihrer Qualität nach beurteilt, sondern berücksichtigt, wenn sie das Tier mehr als nur unwesentlich beeinträchtigen.
Die durch Zuchtmerkmale entstehenden Belastungen werden gemäß Art. 3 der Verordnung über den Tierschutz beim Züchten (TSchZV, Schweiz) in vier Kategorien eingeteilt. Für die Zuordnung eines Tieres zu einer Belastungskategorie ist das am stärksten belastende Merkmal oder Symptom ausschlaggebend (Art. 4 TSchZV, Schweiz).
Kategorie 0 (keine Belastung): Diese Tiere sind zur Zucht zugelassen.
Kategorie 1 (leichte Belastung): Eine leichte Belastung liegt vor, wenn belastende Merkmale oder Symptome bei Heim- und Nutztieren durch geeignete Pflege, Haltung oder Fütterung ohne tiermedizinische Eingriffe oder regelmäßige medizinische Maßnahmen kompensiert werden können.
Kategorie 2 (mittlere Belastung): Mit diesen Tieren darf nur gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel darauf abzielt, die Belastung der Nachkommen im Vergleich zu den Elterntieren zu verringern.
Kategorie 3 (starke Belastung): Mit diesen Tieren darf nicht gezüchtet werden.
Brachycephalie
(siehe auch Merkblatt Nr. 8 Hund Brachycephalie)
Physisch:
Brachycephalie beschreibt eine verkürzte Schädelform, einschließlich einer stark reduzierten Schnauzenlänge. Eine ausführliche Übersicht von Geiger et al. (2021) beschreibt die anatomischen Veränderungen, die mit dieser Kopfform einhergehen. Der Schädel ist insgesamt kürzer und runder, mit einer flachen Schnauze und verkürzten Nase.
Anders als z.B. bei French Bulldogs und Bulldoggen, ist bei CKCS das größte Problem der Brachycephalie nicht immer die fehlende Nasenlänge, sondern die basioccipitale Synchondrose (eine wichtige Wachstumsfuge der Schädelbasis) ossifiziert vorzeitig, was das Längenwachstum der Schädelbasis hemmt und zur verkleinerten hinteren Schädelgrube führt. Eine vorzeitige Schließung dieser Wachstumsfuge ist kausal am Platzmangel im Hinterhauptsbereich beteiligt.
Mit der Brachycephalie und der extremen Schädelform sind verschiedene Erkrankungen direkt verbunden oder begünstigen deren Entstehung, darunter Erkrankungen der oberen Atemwege (BOAS, siehe dort) und Hornhautulzera. Eine Studie aus Großbritannien mit über 22.000 Hunden identifizierte den Cavalier King Charles Spaniel mit einem Anteil von 10,43 % als eine der häufigsten in der tierärztlichen Praxis vorgestellten brachycephalen Rassen. Generell zeigen brachycephale Hunde im Vergleich zu anderen Rassen einen insgesamt schlechteren Gesundheitszustand.
Zu den weiteren gesundheitlichen Einschränkungen zählen zu enge Nasengänge. Cavalier King Charles Spaniel scheinen einen schlechteren Geruchssinns zu besitzen als nicht-brachycephale Rassen.
Wegen der Veränderungen in der Form des brachycephalen Schädels ist es wahrscheinlich, dass jedes brachycephale Maul verschiedene Zahnanomalien aufweist, die sich in ihrer Schwere und Ausprägung unterscheiden. Dazu können Zahnfehlstellungen und Malokklusion, mangelhafter Durchbruch der permanenten Zähne, Engstand und Zahnrotation mit Risiko für Parodontalerkrankungen sowie Traumata des oralen Weichteilgewebes gehören.
Ein weiteres häufiges Problem betrifft den Tränennasengang. Durch die zuchtbedingte Veränderung des Gesichtsschädels ist dieser oft missgebildet, verkürzt oder zeigt eine starke Steilstellung. Dies kann den Abfluss der Tränenflüssigkeit erheblich beeinträchtigen. Infolgedessen läuft die Tränenflüssigkeit nach außen über das Auge ab, was sich durch eine sogenannte „Tränenstraße“ mit bräunlicher Fellverfärbung äußert. Verläuft diese zusätzlich in einer Falte, kann es zu Dermatitis kommen.
Psychisch:
Brachycephale Rassen sind im Vergleich zu nicht brachycephalen Hunden signifikant häufiger von verschiedenen Erkrankungen betroffen. Ihre Lebenserwartung ist im Vergleich zu meso- und dolichocephalen Rassen reduziert. Dies wird auf die mit der Brachycephalie assoziierten gesundheitlichen Probleme wie BOAS, Wirbelsäulenerkrankungen und weitere Prädispositionen zurückgeführt. Die Brachycephalie beeinträchtigt wesentliche Lebensbereiche wie Atmung, Schlaf, Futteraufnahme, Spielverhalten, Temperaturregulation und allgemeine Belastbarkeit. Dies führt zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität betroffener Hunde.
Belastungskategorie: 3
Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom (BOAS)
Physisch:
Das brachycephale obstruktive Atemwegssyndrom (BOAS) beschreibt eine Kombination von Anomalien der oberen Atemwege, die bei Hunden zu einer teilweisen oder vollständigen Obstruktion führen. Die Schädelform spielt hierbei eine zentrale Rolle: Je ausgeprägter die Brachycephalie, desto höher ist das Risiko für die Entstehung von BOAS. Obwohl der Cavalier King Charles Spaniel eine geringere Prävalenz aufweist als Rassen mit stark ausgeprägter Brachycephalie, treten dennoch vielfältige primäre und sekundäre Veränderungen auf.
Zu den primären anatomischen Komponenten zählen kongenitale Merkmale wie stenotische Nasenlöcher, ein verlängerter weicher Gaumen, eine hypoplastische Luftröhre und nasopharyngeale Turbinate. Erhöhte Luftturbulenzen und ein gesteigerter Atemwiderstand können in der Folge sekundäre Veränderungen begünstigen, etwa Gaumen- und Kehlkopfödeme, Schwellungen, Eversion von Kehlkopfsäcken und Tonsillen sowie Kehlkopfkollaps. Diese Veränderungen können zu lebensbedrohlichen Beeinträchtigungen der Atmung führen. Betroffene Hunde können dabei eine beliebige Kombination der genannten Defekte aufweisen, was zu unterschiedlich starken Einschränkungen der oberen Atemwege führt.
Auch die unteren Atemwege können betroffen sein. Veränderungen und das Kollabieren der Bronchien sowie Aspirationspneumonien treten gehäuft bei brachycephalen Rassen auf.
Zu den typischen Symptomen gehören Schnarchen, Husten, geräuschvolles Atmen (Stertor/Stridor), Atemnot, Aufstoßen, Erbrechen, verminderte Belastbarkeit, Blaufärbung der Schleimhäute (Zyanose) und Ohnmachtsanfälle (Synkope). Eine effektive Thermoregulation über Verdunstung an der Nasenschleimhaut ist durch die anatomischen Veränderungen kaum möglich, was in Kombination mit gestörtem Hecheln zu Überhitzung führen kann. Bei gravierender klinischer Symptomatik ist eine Therapie mittels Intubation, Sauerstoffgabe, Abkühlung und/oder Sedation erforderlich.
Der Cavalier King Charles Spaniel ist bei Hunden mit Atemnot signifikant überrepräsentiert. Das mediane Alter dieser Rasse liegt häufig deutlich unter dem sonstigen Durchschnitt von über neun Jahren. Neben den Atemwegen kann auch der Gastrointestinaltrakt betroffen sein, etwa durch Veränderungen des Ösophagus oder des Darms.
Es werden verschiedene operative Eingriffe empfohlen um die Atemwegsobstruktionen zu beheben und somit die Lebensqualität der Hunde zu verbessern. Besonders kritisch ist dabei die postoperative (Aufwach-)Phase, die intensive Beobachtung und Pflege erfordert. Sie verweisen jedoch auch darauf, dass eine vollständige Behebung der Probleme nicht zwangsläufig erreicht wird.
Psychisch:
Die primären und sekundären Veränderungen im Rahmen von BOAS können zu lebensbedrohlichen Beeinträchtigungen der Atmung führen. Betroffene Hunde leiden unter chronischer Atemnot und müssen überwiegend mit offenem Maul atmen, obwohl sie obligate Nasenatmer sind. Insbesondere bei hohen Außentemperaturen ist ihre Aktivität aufgrund der beeinträchtigten Thermoregulation stark eingeschränkt.
Darüber hinaus führt die Bewegungs- und Hitzestressintoleranz – die bereits bei jeder Form von Aufregung, ob positiv oder negativ, zur Gefahr werden kann – zu einer massiven Einschränkung des arttypischen Verhaltens und erhöht die Anfälligkeit für weitere Belastungen.
Belastungskategorie: 3
Chiari-ähnliche Malformation (Chiari-like Malformation/Syringomyelie
Prädisponiert für Chiari-like Malformation mit oder ohne Syringomyelie, sind klein gezüchtete Rassen, die sogenannten Toy Breeds (Gesellschaftshunde) mit verkürzter Schnauze und ausgeprägtem Stop. Am häufigsten werden solche Veränderungen für den Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, Griffon Bruxellois, Affenpinscher, Chihuahua, Yorkshire Terrier, Malteser und Pomeranian (Zwergspitz) berichtet. Weniger häufig betroffene Rassen sind French Bulldog, Boston Terrier und Mops. Eine Chiari-Malformation ist nicht zwingend mit einer Syringomyelie verbunden, kann jedoch selbst bereits zu tierschutzrelevanten klinischen Erscheinungen (Schmerzen ) führen.
Physisch:
Ätiologie
Die Chiari-like Malformation (CM) ist eine Erkrankung, bei der das Gehirn in Relation zum Schädel zu groß ist, was zu einer Blockade der Öffnung zwischen Schädel und Wirbelsäule führt. Dies beeinträchtigt den Liquorfluss um und innerhalb des Rückenmarks, was zur Bildung von flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen im Rückenmark führt, die als Syringomyelie bezeichnet werden. Diese Hohlräume können entweder den zentralen Rückenmarkskanal umschließen oder sich davon abgrenzen.
Beim Cavalier King Charles Spaniel ist die CM durch eine abweichende Form des Hinterhauptbeins (Os occipitale) gekennzeichnet. Diese strukturelle Anomalie führt zu einem reduzierten Volumen der kaudalen Schädelgrube, wodurch das Kleinhirn sowie häufig der Hirnstamm nach kaudal in oder durch das Foramen Magnum in den Wirbelkanal verlagert werden (Kleinhirnherniation).
In einer Studie zeigten 92 % der Cavalier King Charles Spaniel mindestens eine morphologische Anomalie, die mit einer Chiari-ähnlichen Malformation übereinstimmt.
Die betroffenen Bereiche beschränken sich nicht nur auf den kranialen zervikalen Bereich, sondern können auch weiter kaudal gelegene Regionen des Rückenmarks betreffen.
Klinische Symptome treten meist zwischen dem 6. Lebensmonat und dem 2. Lebensjahr auf. Zudem gelten Verzwergung und Brachycephalie als Risikofaktoren für die Entwicklung dieser Malformation.
Die genaue Ursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die wahrscheinlichste Theorie geht davon aus, dass eine Blockade des normalen Flusses der Gehirn-Rückenmarks- Flüssigkeit (Liquor cerebrospinalis, Cerebrospinalflüssigkeit: CSF) im Rückenmark zu einem Druckungleichgewicht führt. Wenn der CSF-Druck nicht richtig mit dem Druckanstieg durch das Herz synchronisiert ist, kann die Flüssigkeit in den perivaskulären Raum um die Blutgefäße fließen und letztlich zur Bildung einer Syrinx führen. Die Erkrankung tritt oft erst in einem späteren Lebensstadium auf und kann häufig erst ab einem Alter von fünf Jahren eindeutig diagnostiziert werden.
Risikofaktoren
Mögliche Risikofaktoren beim Cavalier King Charles Spaniel könnten die im Vergleich zu anderen Rassen kleinere Schädelgrube, der frühe Verschluss der spheno-okzipitalen Schädelnähte sowie möglicherweise weiterer Nähte sein. Zudem zeigen diese Hunde häufiger zerebelläre Deformationen aufgrund des supraokzipitalen Knochens sowie einer Vorwölbung des Wurmfortsatzes. Diese Befunde, kombiniert mit dem gleichzeitigen Auftreten von okzipitaler Dysplasie und Hypoplasie, legen nahe, dass der Cavalier King Charles Spaniel zusätzliche prädisponierende Faktoren für die Entwicklung einer Syringomyelie aufweisen könnte.
Auch kleine oder fehlende Stirnhöhlen sowie ein verkleinertes Foramen jugulare (die Öffnung an der Schädelbasis für Nerven und Gefäße) wurden als mögliche Faktoren für die Entstehung dokumentiert. Diese Faktoren können den venösen Abfluss beeinträchtigen und zu einem Anstieg des intrakraniellen Drucks führen. Ein vergrößertes Volumen eines bestimmten Gehirnteils (Hinterhirn, Rautenhirn) sowie eine abnormale Entwicklung des Hinterhauptbeins werden ebenfalls als Ursache diskutiert.
Es gibt Hinweise darauf, dass eine Hypoplasie des Okzipitalknochens nicht zwangsläufig die Ursache der Syringomyelie bei dieser Rasse ist. Da Cavalier King Charles Spaniels mit und ohne Syringomyelie ähnliche Volumina des Okzipitalknochens aufweisen, könnte dies darauf hindeuten, dass noch weitere Faktoren an der Entstehung der Erkrankung beteiligt sind. Anomalien im Übergangsbereich zwischen Schädel und Wirbelsäule scheinen keinen Einfluss auf den zukünftigen klinischen Verlauf und die Entwicklung von Syringomyelie zu haben.
Im weitesten Sinne kann die Chiari-Malformation (CM) als jede Deformation des Schädels und des Übergangs zwischen Schädel und Wirbelsäule beschrieben werden, die das Nervenparenchym sowie die Liquorzirkulation beeinträchtigt und Schmerzen und/oder Syringomyelie verursacht. Die Ursachen der CM sind vielfältig und könnten genetisch bedingte, rassespezifische Anomalien sowohl der skelettalen als auch der neuralen Strukturen umfassen. Da der kausale Zusammenhang zwischen bestimmten morphologischen Veränderungen und Syringomyelie oder klinischen Symptomen nicht nachgewiesen ist, schlagen Knowler et al. (2018) vor, die Chiari-Malformation eher als brachycephales obstruktives Liquorkanalsyndrom (BOCCS) zu betrachten, statt als eine isolierte Fehlbildung.
Im Jahr 2011 haben die British Veterinary Association (BVA) und der Kennel Club (KC) als Teil des CM/SM-Gesundheitsscreening-Programms drei Grade für CM (CM 0–2) definiert, wobei die Morphologie des Kleinhirns als Maß für die Überfüllung der kaudalen Fossa bewertet wird. Allerdings bezieht sich dieses historische, durch das Kleinhirn definierte Bewertungssystem weder auf den Schweregrad von SM, noch berücksichtigt es Hunde ohne CM, aber mit SM.
Prävalenz und Forschungslage
Weitere Forschung ist erforderlich, um die Zusammenhänge zwischen der Chiari-ähnlichen Malformation (CM) und der Syringomyelie (SM) besser zu verstehen.
Beim Cavalier King Charles Spaniel ist die Prävalenz dieser Erkrankungen deutlich erhöht.
Der Cavalier King Charles Spaniel weist im Vergleich zu Mischlingshunden ein signifikant höheres Risiko für eine CM/SM-Diagnose auf. Die Schwankungsbreite bei der Prävalenz von CM und SM ist groß und die Prävalenzraten für CM/SM beim Cavalier King Charles Spaniel liegen je nach Quelle zwischen 25 %, 70 % und in manchen Studien sogar 92 bis 100 %.
In Dänemark konnte eine Studie eine Prävalenz von 15,4 % für das Auftreten einer symptomatischen Syringomyelie bei Cavalier King Charles Spaniels ermitteln. Bei Hunden aus den Niederlanden und Dänemark konnte festgestellt werden, dass MRT-basierte Screenings und daran angepasste Zuchten die Prävalenz von Syringomyelie von 38 % auf 27 % reduzieren konnten.
Bezüglich weiterer anatomischer Auffälligkeiten im Zusammenhang mit CM, wie einer atlanto-okzipitalen Überlappung, wurde eine Prävalenz von 86 % bei Cavalier King Charles Spaniels festgestellt.
Klinische Symptome und Auswirkungen
Die häufigsten klinischen Symptome der Chiari-ähnlichen Malformation (CM) und der Syringomyelie (SM) beim Cavalier King Charles Spaniel sind:
- Schmerzäußerungen bei Bewegung
- Schmerzäußerungen während Kratzen an Ohren oder Kopf
- Phantomkratzen im Schulter- und Nackenbereich (ohne Hautkontakt)
- Sichtbare Symptome und Schmerzäußerungen bei Berührung im Nacken-, Gliedmaßen- und Ohrenbereich
- uncharakteristische Aggression bei Berührung
- Neurologische Defizite, darunter:
- Defizite der unteren Motoneuronen in den Vordergliedmaßen
- Propriozeptive Defizite
- Ataxie
- Gesichtslähmung
Bei einer klinisch auffälligen Syringomyelie wird häufig das sogenannte Phantomkratzen in Richtung Nacken oder Brustbein beschrieben, bei dem die Haut aber nicht berührt wird. Je nach Ausmaß der Syringomyelie kann es zu Schwäche, Muskelatrophie und propriozeptiven Defiziten der Gliedmaßen kommen.
Klinische Anzeichen für neuropathischen Schmerz im Zusammenhang mit CM/SM verschlimmern sich bei der Mehrheit der betroffenen Hunde, wenn sie nicht operativ behandelt werden. Die zunehmende Größe der Syrinxen führt zu progressiven neurologischen Schäden durch direkten Druck auf das neuronale Gewebe und Ischämie. Die funktionalen Beeinträchtigungen hängen von der genauen Lokalisation der neuronalen Schädigung ab und können Skoliose, Gangstörungen und weitere Symptome umfassen.
Psychisch:
Schmerz wird in der Literatur als häufigstes und wichtigstes klinisches Zeichen der Syringomyelie beschrieben. Die durch die Chiari-ähnliche Malformation verursachten neuropathischen Schmerzen erhöhen das angst- und furchtbasierte Verhalten und verringern die Lebensqualität der betroffenen Hunde erheblich.
Zusätzlich beeinträchtigen die neurologischen Symptome (propriozeptive Defizite, Ataxie, Gesichtslähmung) das Wohlbefinden und die Bewegungsfähigkeit der Tiere weiter.
Belastungskategorie: 3
Mitralklappenerkrankungen
Physisch:
Der Cavalier King Charles Spaniel ist für degenerative Veränderungen der Herzklappen prädisponiert. In einer retrospektiven Studie in einer Klinik in Großbritannien war der Cavalier King Charles Spaniel mit 32,4 % die am häufigsten vertretene Rasse, bei der eine degenerative Mitralklappeninsuffizienz diagnostiziert wurde. Im Vergleich zu Mischlingshunden war das Risiko für eine degenerative Mitralklappeninsuffizienz um mehr als das 40-fache erhöht. Ab einem Alter von 10 Jahren sind bis zu 90 % der CKCS betroffen. Cavalier King Charles Spaniel mit einer Mitralklappeninsuffizienz weisen zudem mit 9,6 % eine erhöhte Inzidenz an Rupturen der Chordae tendineae auf. Es wurde festgestellt, dass Cavalier King Charles Spaniels mit degenerativer Mitralklappeninsuffizienz im Vergleich zu Mischlingshunden ein um das 2,78-fache erhöhtes Sterberisiko haben. Die Ergebnisse der Studie lassen annehmen, dass CKCS anfälliger für schwerwiegende Folgen der Erkrankung sein könnten und daher eine intensivere medizinische Betreuung benötigen.
Ein Drittel der untersuchten Cavalier King Charles Spaniels weisen Herzgeräusche auf. Diese deuten auf bestehende oder sich entwickelnde Herzkrankheiten hin. Die Herzinsuffizienz fällt durch zunehmende Dyspnoe, Synkopen, Husten, Belastungsintoleranz und nächtliche Unruhe auf.
Im Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA besaßen Cavalier King Charles Spaniels zwischen 2016 und 2021 ein über 7-fach erhöhtes relatives Risiko für die Entwicklung von Herzerkrankungen im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Rassen.
Bei einer Untersuchung des Zusammenhangs zwischen einer Mitralklappenerkrankung und dem Auftreten von SM beim Cavalier King Carles Spaniel wurden deutlich kleinere linke Ventrikel und Vorhöfe bei Tieren mit symptomatischer SM im Vergleich zu solchen mit asymptomatischer SM beobachtet.
Psychisch:
Es wird angenommen, dass Cavalier King Charles Spaniels anfälliger für schwerwiegende Auswirkungen von Erkrankungen der Mitralklappen sind und daher eine intensivere medizinische Betreuung benötigen. Zudem können betroffene Hunde durch die Dyspnoe und Belastungsintoleranz in ihrem Verhalten eingeschränkt sein.
Belastungskategorie 3
Augenerkrankungen
Physisch:
Das Brachycephale Augensyndrom (Brachycephalic Ocular Syndrome, BOS) umfasst anatomische und physiologische Merkmale, die bei brachycephalen Hunden auftreten und mit einer erhöhten Anfälligkeit für Augenoberflächenerkrankungen einhergehen. Eine enge, gleichzeitig flache Augenhöhle führt zu hervortretenden Augen (Exophthalmus), wodurch der Augapfel weniger geschützt ist. Zudem weisen einige brachycephale Hunde eine leichte nach außen gerichtete Abweichung der Sehachse auf (lateraler Strabismus/Exotropie), was die Innenseite des Augapfels zusätzlich frei legt.
Makroblepharon: Eine weitere prädisponierende Veränderung ist das Makroblepharon – eine vergrößerte Lidspalte zwischen Ober- und Unterlid. In Kombination mit Exophthalmus, Trichiasis der Nasenfalte (Haare, die an den Augen reiben) und Anomalien des Tränennasenapparates erhöht dies das Risiko für Hornhautulzera und traumatische Proptosis erheblich. Die Prävalenzen für Hornhautgeschwüre liegen für den Cavalier King Charles Spaniel zwischen 2,49 % und 11,5% . Da die meisten cornealen Nervenfasern Schmerzrezeptoren sind, verursachen Schäden an der Hornhaut starke Schmerzen.
Weitere häufige Augenerkrankungen dieser Rasse sind Keratitis und Keratokonjunktivitis sicca. Durch Tränenfilmmangel, Fehlbildungen der Lider, chronische Exposition und oberflächliche Traumata kann es zu einer chronischen Keratitis kommen, die durch Neovaskularisation, Entzündungsinfiltrate, epitheliale Hyperplasie und Pigmentierung gekennzeichnet ist. Dies erhöht möglicherweise das Risiko für Plattenepithelkarzinome der Hornhaut. Tiefere Hornhautschichten scheinen bei brachycephalen Hunden häufiger betroffen zu sein.
Die Prävalenzen beim CKCS für eine Keratokonjunktivits sicca liegen je nach Studie zwischen 1,91 % und 3,5 % . Typische klinische Anzeichen sind ein zähflüssiger, mukopurulenter Augenausfluss, verklebte Lider und erhebliche Schmerzen.
Auch Katarakte treten bei dieser Rasse gehäuft auf. Die Prävalenz war in der Altersgruppe zwischen 10 und 15 Jahren mit 6,56 % am höchsten.
Der Cavalier King Charles Spaniel ist laut ACVO (2023) mit einer Prävalenz von ca. 9% von Distichiasis betroffen. Distichiasis bezeichnet zusätzliche Wimpern bei Hunden, die aus den Meibom-Drüsen am Rand des Augenlids hervorgehen und in Richtung des Augapfels wachsen. Diese Wimpern können zu Reizungen der Hornhaut führen.
Epitheliale Dystrophie der Hornhaut: Die epithelial-stromale Hornhautdystrophie ist gekennzeichnet durch die Ansammlung von weißen bis grauen Trübungen, die meist aus Lipiden bestehen, in einer oder mehreren Schichten der Hornhaut. Diese Erkrankung führt in der Regel nur selten zu Schmerzen oder Erblindung. Der Kavalier King Charles Spaniel ist prädisponiert für diese Augenerkrankung. Die Prävalenz der Erkrankung gibt die ACVO (2023) mit ca. 8% an.
Augenprobleme sind mit einer Prävalenz von ca. 20 % die dritthäufigste Erkrankung beim Cavalier King Charles Spaniel. Davon haben den größten Anteil die Hornhauterkrankungen mit ca. 42 %, gefolgt von Konjunktivitis (29,5%), Katarakt (9,7%) und Uveitis (3,4%). Im Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA besaß der Cavalier King Charles Spaniel zwischen 2016 und 2021 ein 2,5-fach erhöhtes relatives Risiko für die Entwicklung von Augenerkrankungen im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen dort versicherten Rassen. Die OFA gibt in ihrer Teststatistik für den Cavalier King Charles Spaniel eine Prävalenz für Augenerkrankungen von ca. 5% an.
Psychisch:
Die Hornhaut wird von nozizeptiven afferenten Nervenzellen innerviert, weshalb Schäden am Auge starke Schmerzen verursachen können.
Ulzerative Veränderungen der Cornea können das Wohlbefinden der betroffenen Hunde erheblich beeinträchtigen. Diese Erkrankungen können nicht nur starke Schmerzen auslösen, sondern auch zu Uveitis, Perforation der Cornea, Verlust des Augapfels und einer deutlichen Einschränkung des Sehvermögens führen. Neben der Beeinträchtigung der Sehfähigkeit stellt der mögliche Verlust des Auges eine erhebliche Belastung für die betroffenen Hunde dar.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Erkrankung und Ausprägungsgrad
Congenitale Keratoconjunctivitis sicca und Ichthyosiforme Dermatose (CKCSID) – Dry Eye Curly Coat Syndrom
Manche Cavalier King Charles Spaniels leiden an einer Kombination aus Keratokonjunktivitis sicca und Ichthyosis, einer genetischen Erkrankung, die zu rauem, schuppigem Fell und Hautveränderungen führt. Diese auch “Dry Eye Curly Coat Syndrom” genannte Erkrankung tritt nur beim Cavalier King Charles Spaniel auf und besteht aus einer Kombination von zwei primären Krankheitsprozessen:
- Keratokonjunktivitis sicca: Eine verminderte Tränenproduktion führt zur Trockenheit der Augenoberfläche. Zu den häufigsten Symptomen zählen Rötungen in einem oder beiden Augen sowie ein dicker, schleimiger Ausfluss. Chronisch trockene Augenoberflächen sind anfällig für Hornhautgeschwüre und können auch schmerzhafte sekundäre bakterielle Bindehautentzündungen verursachen.
- Ichthyosiforme Dermatose: Die Erkrankung äußert sich typischerweise durch ein raues und lockiges Fell, das mit multifokaler Alopezie einhergehen kann. Die Haut ist in der Regel trocken, schuppig und neigt zum Abblättern, insbesondere im Bereich der Rückenwirbelsäule und an den seitlichen Flanken. Der Bauch kann eine hyperpigmentierte Erscheinung aufweisen, während die Fußballen häufig Anzeichen von Hyperkeratinisierung zeigen. Darüber hinaus können die Nägel auffällige Wachstumsanomalien aufweisen.
Physisch:
Im Jahre 2015 wurden ca. 3,5 % der Tiere mit dem Syndrom diagnostiziert. Laut der Teststatistik der ACVO sind 3% der getesteten Tiere Träger der Genmutation.
Betroffene Welpen kommen mit untypischem, lockigem Fell zur Welt. Im Laufe der Zeit wird das Fell des Hundes zunehmend fettig und beginnt auszufallen. Die Haut fängt an zu schuppen, was zu Juckreiz und Reizungen führt. Neben der Haut sind auch die Fußsohlen betroffen, die sich verdicken und verhärten. Schließlich können die Fußsohlen aufplatzen. Auch die Nägel leiden unter der Erkrankung, was zu brüchigen Nägeln und rissigen Pfotenballen führt, die sehr schmerzhaft sind und dazu führen, dass der Hund hinkt.
Sobald die Augen des Welpen sich zwischen dem 10. und 14. Lebenstag öffnen, hat er mit extrem trockenen, klebrigen und schmerzhaften Augen zu kämpfen, die später auch Augenausfluss aufweisen. Ein Mangel an Tränenflüssigkeit führt zu Schäden an der Hornhaut, was äußerst schmerzhaft ist. Im Laufe der Zeit wird die Hornhaut undurchsichtig, was zur Erblindung des Tieres führen kann. Viele betroffene Hunde müssen aufgrund der schlechten Prognose und des fehlenden Therapieerfolgs euthanasiert werden.
Psychisch:
Die Hornhaut wird von nozizeptiven afferenten Nervenzellen innerviert, weshalb Schäden am Auge starke Schmerzen verursachen können. Die Augenerkrankungen können, abhängig von ihrem Schweregrad, die Sehfähigkeit der Hunde beeinträchtigen. Hunde mit stark eingeschränktem Sehvermögen oder Blindheit haben Schwierigkeiten, Körpersignale wie Körperhaltung, Schwanzhaltung sowie Augen-, Kopf- und Maulzeichen zu nutzen oder bei anderen Hunden zu erkennen. Dies kann zu Veränderungen im Verhalten, Ängstlichkeit und Unsicherheit führen. Ein beeinträchtigtes oder fehlendes Sehvermögen schränkt die Tiere somit erheblich in ihrem arttypischen Verhalten und ihrem Wohlbefinden ein.
Belastungskategorie: 3
Chondrodystrophie und Chondrodysplasie inkl. Bandscheibenerkrankungen
siehe auch Merkblatt Nr. 31 Hund Rasse Basset-Hound
Physisch:
Chondrodystrophie und Chondrodysplasie sind Entwicklungsstörungen des Knorpels und Knochens, die zu verkürzten Gliedmaßen führen. Chondrodystrophe Rassen zeigen zudem eine chondroide Metaplasie des Nucleus pulposus, die eine vorzeitige Degeneration und Verkalkung der Bandscheiben begünstigt. Diese Veränderung des ursprünglich gallertartigen, halbflüssigen Nucleus pulposus hin zu einer trockeneren, festeren Struktur kann bereits im Alter von 3–4 Monaten auftreten. Bei der Mehrheit der chondrodystrophen Hunde ist der Nucleus pulposus im Alter von zwei Jahren weitgehend durch chondroides Gewebe ersetzt.
Chondrodystrophie umfasst nicht nur eine Skelettdysplasie mit kurzen Gliedmaßen, sondern auch eine progressive Degeneration der Bandscheiben (Intervertebral Disc Disease, IVDD) nach der Geburt. Besonders häufig betroffen ist der thorakolumbale Bereich der Wirbelsäule. Klinisch äußert sich die Erkrankung in unterschiedlich starken Schmerzen und neurologischen Defiziten. Die Symptome treten meist akut auf und reichen von leichter Schmerzhaftigkeit ohne neurologische Ausfälle bis hin zu schweren Myelopathien mit Lähmungen und vollständigem Verlust des Schmerzempfindens.
Psychisch:
Bandscheibenerkrankungen gehen oft mit Rückenmarksverletzungen einher, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können. Betroffene Hunde leiden häufig unter starken Schmerzen. Chronische Fälle, insbesondere Hunde mit Paraplegie, erfordern aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität und Inkontinenz eine intensive, zeit- und kostenaufwendige Betreuung durch die Tierhalter*innen.
Belastungskategorie: 3
Degenerative Myelopathie
Physisch:
Die Degenerative Myelopathie beim Cavalier King Charles Spaniel liegt laut der Orthopedic Foundation for Animals (OFA) bei 24,4 % der getesteten Tiere vor und 33, 4 % waren Träger des Gens.
Ca. 70% der getesteten Cavalier King Charles Spaniel waren in einer Untersuchung über die Häufigkeit der Erkrankung bei unterschiedlichen Rassen Träger der Mutation und 49,3 % der Tiere besaßen ein hohes Risiko an degenerativer Myelopathie zu erkranken.
Die schwedische Tierversicherung AGRIA berichtet in ihrem Breed Report (2016-2021) auf Basis ihrer erhobenen Daten für die Rasse von einem ca. 12-fach erhöhten relativen Risiko für eine Rückenmarkserkrankung im Vergleich zu dem Durchschnitt aller anderen dort versicherten Hunderassen.
Die degenerative Myelopathie ist eine Erkrankung des Rückenmarks, bei der die Nervenfasern allmählich abgebaut werden. Die Symptome treten häufig zwischen dem fünften und achten Lebensjahr auf, können jedoch auch schon in jüngerem Alter in unterschiedlicher Intensität erscheinen. Typische Anzeichen sind ein unsicherer Gang und Muskelschwäche in den Hinterbeinen. Der Zustand verschlechtert sich kontinuierlich, und innerhalb von wenigen Monaten bis zu einem Jahr kann die Funktion der Hinterbeine stark eingeschränkt sein, sodass sie kaum noch genutzt werden können. Zudem kann der Hund aufgrund des Verlusts von Nerven, die für die Blasen- und Darmkontrolle zuständig sind, inkontinent werden. Diese Erkrankung wird mit der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) beim Menschen in Verbindung gebracht, wobei ähnliche Mutationen des SOD1-Gens als mögliche Ursachen identifiziert wurden.
Psychisch:
Myelopathien gehen häufig nicht nur mit Lähmungserscheinungen, sondern auch mit hochgradigen Schmerzen einher, die das Wohlbefinden des Tieres erheblich beeinträchtigen.
Belastungskategorie: 3
Primary Secretory Otitis Media (PSOM)
Bei der primären sekretorischen Otitis media (PSOM) handelt es sich um nicht-infektiöse Ergüsse, die im Mittelohr auftreten. Beim Cavalier King Charles Spaniel wird bei bildgebenden Verfahren gehäuft Material im Mittelohr vorgefunden. Die Prävalenzen liegen je nach Quelle zwischen 50 und 54 %. Ursächlich ist wahrscheinlich eine erhöhte Produktion von viskösem Mukus (Schleim) oder ein gestörter Abfluss aus dem Mittelohr, wobei auch eine Kombination beider Erscheinungen möglich wäre. Das Trommelfell ist in der Regel intakt und das Mittelohr ist mit stark viskösem, undurchsichtigen, gräulichen oder gelblichen Material (Pfropf) gefüllt. Es gibt keine Beteiligung von Erregern, was auf einen nicht-infektiösen Erguss hinweist. Bei brachycephalen Hunden, zu denen auch der Cavalier King Charles Spaniel gehört, ist die Inzidenz signifikant höher. Dies wird durch die veränderte Schädelanatomie erklärt, die einen verdickten weichen Gaumen und einen reduzierten nasopharyngealen Raum umfasst. Einige Studien haben Veränderungen im Schädel und den darin befindlichen Strukturen identifiziert, die mit Brachycephalie in Verbindung stehen und die Entstehung von PSOM begünstigen können. Beim Cavalier King Charles Spaniel konnten außerdem im Vergleich zu anderen Hunderassen, strukturelle Unterschiede des Mittelohrs nachgewiesen werden, die einen Einfluss auf die Entstehung von PSOM haben könnten, auch wenn andere Untersuchungen keinen Zusammenhang zwischen Veränderungen der Bulla tympanica und Mittelohrergüssen herstellen konnten.
Zu den potenziellen klinischen Symptomen gehören Hörverlust, neurologische Auffälligkeiten, wie Fazialisparese, Nystagmus, Kopfschiefhaltung und Ataxie, Kopf- und Nackenkratzen, Juckreiz im Ohr, abnormales Gähnen, Jaulen, Kopfschütteln, Nackenschmerzen und schmerzhafte Ohren. Der Zusammenhang zwischen einem Erguss im Mittelohr und Hörverlust konnte wissenschaftlich nachvollzogen werden. Die Rassestatistik der schwedischen Tierversicherung AGRIA konnte zeigen, dass zwischen 2016 und 2021 Kavalier King Charles Spaniels deutlich häufiger mit einer Otitis in einer Tierarztpraxis vorstellig waren und ein ca. 14-fach erhöhtes relatives Risiko für Hörminderung oder Taubheit im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen versicherten Rassen besaßen.
Ein Hörverlust kann auch dann nachgewiesen werden, wenn Halter*innen bis dahin keine Auffälligkeiten bemerkt hatten. In einer Untersuchung waren 70 % der Hunde bilateral und 30 % unilateral betroffen. In anderen Studien war die Häufigkeit von uni- und bilateralen Ergüssen gleichmäßig verteilt. Die Hunde können allerdings auch asymptomatisch sein. Häufig werden betroffene Hunde mit weiteren Erkrankungen, wie Chiari-ähnlicher Malformation oder Syringomyelie oder mit allen drei Erkrankungen diagnostiziert.
Psychisch:
Mögliche Symptome, wie Juckreiz und Ataxien beeinträchtigen die Hunde in ihrem arttypischen Verhalten und Wohlbefinden. Die Sekretansammlung im Mittelohr führt zu einem Druckgefühl, das für die Hunde sehr schmerzhaft ist. Eine reduzierte Aktivität und beeinträchtigte Bewegung, wie erschwertes Abwärtslaufen oder Klettern sowie Springen schränken das arttypische Verhalten der Hunde ein. Das verminderte Hörvermögen beinträchtigt die arttypische Kommunikation mit anderen Hunden und dem Menschen als Bezugsperson, ihre Sinnesleistungen und Verhalten. Die Erkrankung kann erneut auftreten, sodass die Hunde mehrfach unter der Klinik leiden können und wiederholt behandelt werden müssen.
Belastungskategorie: 3
Zahnerkrankungen und Erkrankungen des Zahnhalteapparats
Physisch:
Die veränderte und komprimierte Anatomie des Gesichtsschädels führt bei brachycephalen Tieren, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und Entwicklungsgrad, häufig zu Abweichungen vom normalen Gebisszustand sowie zu damit verbundenen parodontalen Erkrankungen.
Parodontalerkrankungen zählen zu den häufigsten Diagnosen, die bei Hunden in der tierärztlichen Praxis gestellt werden. Einige prospektive Studien zeigen Prävalenzraten von 44 % bis 63,6 %. Parodontitis wird als irreversibel angesehen und führt zur Schädigung des parodontalen Ligaments, des Zements und des Alveolarknochens, was häufig mit dem Verlust von Zähnen einhergeht. Cavalier King Charles Spaniels lagen in einer umfassenden britischen Studie zu caninen Parodontalerkrankungen mit einer Periodenprävalenz von 25,29% an vierter Stelle aller analysierten Rassen. In früheren Studien lag die Prävalenz der Rasse für Zahnerkrankungen/Parondontalerkrankungen zwischen ca. 15 und ca. 25%.
Laut dem Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA hatte der Cavalier King Charles Spaniel zwischen 2016 und 2021 ein 3-4-fach höheres relatives Risiko, Zahnerkrankungen zu entwickeln, im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen versicherten Rassen.
Chronisch-Ulcerative Parodontale Stomatitis (CUPS)
Eine Sonderform der Erkrankungen des Zahnhalteapparats ist die chronisch-ulcerative parodontale Stomatitis (CUPS). Diese ist durch schmerzhafte orale Geschwüre gekennzeichnet, die hauptsächlich in der bukkalen Schleimhaut (Mukositis) auftreten, aber auch auf der Zunge (Glossitis) oder der Gaumenschleimhaut vorkommen können. Es handelt sich um eine immunvermittelte Erkrankung der Maulhöhle kleiner Hunderassen, die vermutlich auf einer Überempfindlichkeit gegenüber Plaquebildung beruht. Eine aktuelle Untersuchung des Mikrobioms betroffener Hunde ergab, dass bei Hunden mit CUPS die Schleimhautulceration von einer speziellen, artspezifischen Bakterienflora besiedelt wird und diesbezüglich erhebliche Unterschiede zwischen der Maulschleimhaut gesunder Hunde und der von Hunden mit schweren Parodontalerkrankungen bestehen. Der Cavalier King Charles Spaniel scheint für die CUPS prädisponiert zu sein.
Chronische Ulcera haben eine erhebliche Morbidität zur Folge, da die Hunde das Fressen ablehnen, an Gewicht verlieren und unter anhaltenden Schmerzen im Mund leiden können. Klinisch zeigen die betroffenen Tiere eine Vielzahl von Symptomen auf, darunter unangenehmer, manchmal starker Geruch aus dem Maul, Inappetenz oder Anorexie, übermäßiger Speichelfluss mit dickflüssigem und gelegentlich blutigem Speichel und Schmerzen im Maulbereich (z. B. Pfoten im Maul oder klappernde Kieferbewegungen). Weitere mögliche Symptome sind ungewöhnliche Kaubewegungen, Fressprobleme und Blutungen im Mund. Betroffene Hunde neigen oft dazu, nicht mehr auf ihrem Spielzeug zu kauen und lehnen die harten Bestandteile ihrer Nahrung ab.
Eine konservative Therapie mit Plaqueentfernung, antibakterieller, antiinflammatorischer oder immunsuppressiver Medikation verbunden mit strikter Maulhygiene (Zähneputzen) kann versucht werden, ist aber häufig erfolglos. In der Regel kann bei den Tieren eine Heilung nur durch Teil- oder vollständige Extraktionen des Zahns erreicht werden.
Psychisch:
In einer Untersuchung, die die Auswirkungen häufiger Erkrankungen auf das Wohlbefinden von Hunden analysierte, wurde festgestellt, dass Zahnerkrankungen und schmerzhafte Erkrankungen der Maulschleimhäute gravierende Auswirkungen auf das Wohlbefinden der betroffenen Tiere haben.
Bei Tieren mit CUPS können selbst mildere Formen dieser entzündlichen Erkrankung im Maul zu starken Schmerzen führen, die die Lebensqualität der Tiere erheblich einschränken. Je nach Ausprägungsgrad können die Tiere aufgrund der Schmerzen die Grundbedürfnisse der Futter- und Wasseraufnahme nicht mehr oder nur eingeschränkt erfüllen. Die Erkrankungen kann zu Lethargie und depressionsähnlichem Verhalten führen.
Es ist zu beachten, dass Hunde – ähnlich wie Katzen – Schmerzen in diesem Bereich oft nicht zeigen. Selbst bei erheblichen Defekten oder Erkrankungen verweigern sie manchmal keine Nahrung, weil ihr Hunger als Überlebensinstinkt stark ist. Das bedeutet, dass Schmerzen und Leiden vorhanden sein können, ohne dass die Hundehalter das sofort bemerken.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägungsgrad
Episodic Falling Syndrome
Physisch:
Das Episodic Falling Syndrom (EFS) ist eine vererbte Krankheit, die überwiegend Cavalier King Charles Spaniels betrifft. Die Erkrankung wird zu den Dyskinesien (Bewegungsstörungen) gezählt und tritt v.a. bei Aufregung (z.B. Spiel, Besuch, ungewohnte Umgebung) auf. In einer Studie von 2016 wurden 12,3% der getesteten Tiere als Träger der verantwortlichen Mutation identifiziert. Das Episodic Falling Syndrome beim Cavalier King Charles Spaniel liegt laut der Orthopedic Foundation for Animals (OFA) bei 0,3 % der getesteten Tiere vor, während 5,1 % der getesteten Tiere Träger des Gens waren. In einer weiteren Studie waren 39 der getesteten 48 CKCS homozygot für den verantwortlichen BCAN-Genotyp.
EFS ist eine Muskelerkrankung, die einen erhöhten Muskeltonus und eine Muskelspastik (vor allem der Gliedmaßen) verursacht, die dazu führt, dass die Gliedmaßen in einer gestreckten Position „blockiert“ erscheinen. Diese Muskelspastik führt zu einer charakteristischen „betenden“ Position und/oder einem Kollaps. Die Episoden dauern in der Regel einige Sekunden bis mehrere Minuten und klingen von selbst wieder ab. Betroffene Hunde erscheinen zwischen den Episoden neurologisch normal. Der Schweregrad und die Anzahl der Episoden variieren im Laufe des Lebens des Hundes und folgen keinem bestimmten Verlaufsmuster.
Die Episoden beginnen in der Regel im Alter zwischen 14 Wochen und vier Jahren und treten häufig in Verbindung mit Bewegung, Aufregung oder Frustration auf. Diese Episoden können jedoch zu jeder Zeit und unter allen Umständen auftreten.
Psychisch:
Betroffene Tiere sind während der “Anfälle” einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt und es besteht eine erhebliche Beeinträchtigung der arteigenen Verhaltensweisen.
Belastungskategorie: 3
Lebenserwartung und Mortalität
Obwohl kleine Rassen üblicherweise länger leben als große Rassen, liegt der Kavalier King Charles Spaniel mit einer mittleren Lebenserwartung von ca. 10 Jahren ungefähr im Bereich von großen Hunderassen (Zum Vergleich: Der größere King Charles Spaniel besitzt eine mittlere Lebenserwartung von 12 Jahren). Die kürzere Lebenserwartung wird auf die Prädisposition für degenerative Mitralklappenerkrankungen sowie für Syringomyelie zurückgeführt. Herzkrankheiten stellen daher erwartungsgemäß die Hauptursache für den vorzeitigen Tod beim Cavalier King Charles Spaniel dar.
Auch aktuelle Daten der AGRIA zeigen, dass der Cavalier King Charles Spaniel zwischen 2016 und 2021 ein 8-fach erhöhtes relatives Risiko für ein Versterben (oder eine Euthanasie) aufgrund von Herzproblemen, gefolgt von einem 3-fach erhöhten Risiko aufgrund von Atemproblemen im Vergleich zur durchschnittlichen Mortalitätsrate aller dort versicherten Hunderassen besaß. Die Mortalität aufgrund von neurologischen Erkrankungen war mehr als doppelt so hoch wie die der anderen Rassen.
Fazit
Die beim Cavalier King Charles Spaniel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorliegenden Defekte und Schäden rechtfertigen die Aussage, dass eine Weiterzucht kritisch zu sehen ist und wenn überhaupt nur mit komplett untersuchten, getesteten (beide Zuchtpartner) und einem bildgebenden Verfahren zum Ausschluss einer Chiari Malformation/Syringomyelie erfolgen kann.
Zum Thema Zulässigkeit eines Outcross-Verfahrens siehe Punkt 9 “Allgemeine tierschutzrechtliche Bewertung. Deutschland.”
Tierethische Bewertung der Qualzuchtproblematik beim Cavalier King Charles Spaniel
Auf Basis der im QUEN-Merkblatt Nr. 34 genannten Fakten, welche die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von zuchtbedingten Defekten der Belastungskategorien 2-3 (mittlere bis starke Belastung) bzw. 3 (starke Belastung) auflisten, ist aus tierethischer Sicht festzustellen, dass die Weiterzucht mit betroffenen Tieren dieser Rasse als höchst problematisch einzustufen ist, da ein Züchter davon ausgehen muss, dass Tiere, die er durch seine Zucht in die Welt setzt, erheblich und andauernd Schmerzen ertragen müssen oder leiden werden. Dies ist bereits dann inakzeptabel, wenn zumindest einer der im gegenständlichen Merkblatt genannten zuchtbedingten Defekte in den Belastungskategorien 2-3 bei mindestens einem der von ihm gezüchteten Tiere in vorhersehbarer Weise eintritt, wobei „vorhersehbar“ erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann vorliegen, wenn sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen erwartbar auftreten.
6. Vererbung, Genetik, ggf. bekannte Gen-Teste, ggf. durchschnittlicher genomischer Inzuchtkoeffizient (COI) und durchschnittlicher Heterozygotiewert für die Rasse
Brachycephalie
Die genetischen Ursachen der Brachycephalie sind noch nicht vollständig geklärt. Aufgrund der genetischen Komplexität wird angenommen, dass mehrere Chromosomen beteiligt sind. Die Entwicklung dieser Schädelanomalie wird durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Genregulationsnetzwerke, Signalinteraktionen und hierarchischer Kontrollmechanismen beeinflusst. Mehrere Studien haben einen Zusammenhang mit dem CFA1-Gen festgestellt.
Chiari-ähnliche Malformation/Syringomyelie
SM ist ein vielschichtiges Merkmal, das eine moderate Erblichkeit aufweist. CM und SM besitzen einen polygenen Vererbungsmodus mit variabler Penetranz. Der verantwortliche Lokus scheint PCDH17 auf dem Gen CFA22 zu sein. Ein Gentest ist nicht verfügbar.
Mitralklappenerkrankungen
Die genetischen Hintergründe der Mitralklappenerkrankung sind bislang nicht vollständig erforscht. Studien zeigen jedoch, dass verschiedene Gene und microRNAs unterschiedlich zwischen gesunden und erkrankten Hunden exprimiert werden, was auf eine mögliche Beteiligung an der Krankheitsentstehung hinweist. Es scheint kein einzelnes Gen für die Erkrankung verantwortlich zu sein. Untersuchungen legen nahe, dass Abschnitte auf den Chromosomen CFA13 und CFA14 mit der Entwicklung von Mitralklappenerkrankungen beim Cavalier King Charles Spaniel assoziiert sind. In der Region von CFA13 könnte sich das HEPACAM2-Gen befinden, das neben CDK6 und FAH eine Rolle in der Pathogenese spielen könnte. Neuere Studien haben zudem weitere potenziell beteiligte Gene identifiziert. Ein Gentest ist verfügbar.
Congenitale Keratoconjunctivitis sicca und Ichthyosiforme Dermatose (CKCSID) – Dry Eye Curly Coat Syndrom
Die Vererbung der Erkrankung erfolgt autosomal-rezessiv. Es handelt sich um eine Basenmutation (Deletion) auf dem Gen FAM83H auf Chromosom CFA 13.
Ein Gentest ist verfügbar.
Chondrodysplasie und Chondrodystrophie inkl. Bandscheibenerkrankungen
Ein Zusammenhang zwischen Chondrodysplasie und dem FGF4-Retrogen auf Chromosom 18 (CFA18) konnte nachgewiesen werden. Genomstudien zeigten zudem, dass Chondrodystrophie mit einem FGF4-Retrogen auf Chromosom 12 (CFA12) assoziiert ist. Die Vererbung erfolgt dominant.
Die vorzeitige Degeneration der Bandscheiben (Intervertebral Disc Degeneration, IVDD) beruht auf einer Überexpression des FGF4-Retrogens auf CFA12. Dieses Retrogen kommt bei vielen IVDD-anfälligen Hunderassen mit hoher Frequenz vor und führt zu einer 20-fachen Erhöhung der FGF4-Expression in der Bandscheibe. Bereits im Alter von zehn Wochen zeigen betroffene Hunde erste Anzeichen einer chondroiden Metaplasie und Degeneration des Nucleus pulposus.
Ein weiteres FGF4-Retrogen auf CFA18 wird mit Skelettdysplasie und unverhältnismäßigem Zwergwuchs in Verbindung gebracht, scheint aber keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung von IVDD zu haben. Da viele IVDD-gefährdete Rassen sowohl das CFA12- als auch das CFA18-FGF4-Retrogen tragen, ist es schwierig, den genauen Beitrag jedes einzelnen zum Krankheitsbild zu bestimmen. Es wird jedoch angenommen, dass das CFA12-FGF4-Retrogen allein ausreichend ist, um eine vorzeitige Bandscheibendegeneration auszulösen. Ein Gentest ist verfügbar.
Degenerative Myelopathie
Die degenerative Myelopathie, die durch eine Mutation des SOD1-Gens verursacht wird, ist eine vererbte neurologische Störung bei Hunden. Diese Mutation tritt bei vielen Hunderassen auf, auch beim Cavalier King Charles Spaniel. Der Erbgang der Degenerativen Myelopathie ist autosomal-rezessiv mit unvollständiger Penetranz. Ein Gentest ist verfügbar.
Primary Secretory Otitis Media (PSOM)
Die Erkrankung ist vermutlich erblich bedingt, aber bisher gibt es, außer der erhöhten Inzidenz in der Rasse, keine definitiven Hinweise auf eine genetische Komponente.
Chronisch- Ulcerative Parodontale Stomatitis (CUPS)
Eine genetische Prädisposition von kleinen und kurzköpfigen Rassen für die Erkrankung wird vermutet, konnte aber bisher nicht belegt werden, da systematische Untersuchungen dazu fehlen. Insbesondere Malteser und Cavalier King Charles Spaniel scheinen überrepräsentiert zu sein.
Episodic Falling Syndrome
Die Vererbung erfolgt vermutlich autosomal rezessiv.
Die Mutation des BCAN-Gens, die mit dem episodischen Sturzsyndrom verbunden ist, wurde beim Cavalier King Charles Spaniel identifiziert. Zwar ist die genaue Häufigkeit in der gesamten CKCS-Population nicht bekannt, aber 12,9 % von 155 klinisch unauffälligen Cavalier King Charles Spaniels aus den Vereinigten Staaten waren Träger der Mutation. Ein Gentest ist verfügbar.
Für die Rasse angebotene/verfügbare Genteste:
- Chondrodysplasie und Chondrodystrophie (IVDD-Risiko)
- Degenerative Myelopathie (DM), Exon 2
- Dry Eye Curly Coat Syndrome (CKCSID)
- Episodic Falling (EF)
- Hyperurikosurie
- Makrothrombozytopenie
- Maligne Hyperthermie
- MCAD-Defizienz (Medium-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency)
- Mitralklappenendokardiose
- Duchenne Muskeldystrophie
- Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA)
- Xanthinurie Typ II
Grundlage einer verantwortungsvollen Zucht ist bei der sorgfältigen Diagnose des Einzeltieres nicht nur die Beurteilung des Exterieurs und der Verhaltenseigenschaften der Zuchtpartner vor dem ersten Zuchteinsatz, sondern auch die Nutzung moderner molekulargenetischer Diagnostik. Innerhalb eines Screenings sollte diese nicht nur zur Identifizierung von Merkmals- oder Anlageträgern, sondern auch zur Bestimmung des Inzuchtgrades des Einzeltieres genutzt werden. Inzwischen bieten Labore sogenannte „Matching Tools” oder „Mating Scores“ an, welche Züchter nutzen können, um geeignete Zuchtpartner zu identifizieren, wobei gleichzeitig die Verpaarung von Tieren mit gleichen risikobehafteten Anlagen verhindert werden kann. Verschiedene spezialisierte Labore bieten für Züchter entsprechende Beratungen an.
* der nach Abstammung/Ahnentafel berechnete Koeffizient ist nicht ausreichend präzise.
7. Diagnose-notwendige Untersuchungen vor Zucht oder Ausstellungen
Achtung: Invasive, das Tier belastende Untersuchungen sollten nur in begründeten Verdachtsfällen bei Zuchttieren durchgeführt werden und nicht, wenn bereits sichtbare Defekte zum Zucht- und Ausstellungsverbot führen.
Wie Rassestandards, haben auch Zuchtvorgaben oder Zuchtordnungen (im Gegensatz zu tierschutzrechtlichen Normen) keinerlei rechtliche Bindungswirkung und sind diese hinsichtlich einer Zucht- oder Ausstellungseignung bestenfalls von sekundärer Bedeutung. Sind aus wissenschaftlichen und/ oder züchterischen Erkenntnissen in einer Rasse bestimmte zuchtbedingte Defekte oder Dispositionen zu Erkrankungen, welche den Tieren selbst oder Ihren Nachkommen Schmerzen Leiden ODER Schäden zufügen können bekannt, dann sind Entscheidungen darüber, welche Untersuchungen ggf. zum Nachweis einer Zucht- oder Ausstellungseignung notwendig erscheinen, ausschließlich auf Grundlage neutraler, unter wissenschaftlichen Kautelen erhobener Befunde durch die örtlich zuständige Behörde festzulegen. Die Veterinärbehörde kann erforderlichenfalls auch die Anpassung von Zuchtzulassungsbestimmungen oder Zuchtordnungen an aktuelle medizinische Erkenntnisse anordnen und/ oder zum Nachweis der Ausstellungseignung für bestimmte Rassen Untersuchungen zum Nachweis des Nichtvorliegens von zuchtbedingten Defekten vorgeben. Es sind grundsätzlich nicht Züchter oder Zuchtverbände, die rechtlich verbindliche Aussagen darüber treffen können, welches Defektmerkmal, oder ab welchem Schweregrad ein Defektmerkmal zum Zucht- oder Ausstellungsverbot führt.
Brachycephalie
Neben Anamnese, typischem Aussehen, ggf. Vermessung der Proportionen und allgemeiner Untersuchung können verschiedene bildgebende Verfahren und funktionelle Tests zur Diagnostik der Brachycephalie herangezogen werden. Das brachycephale Syndrom kann mittels bildgebender Verfahren diagnostiziert werden. Röntgenaufnahmen ermöglichen kraniometrische Messungen, während CT und Endoskopie eine detaillierte Darstellung der oberen Atemwege bieten.
Eine praxisrelevante Methode der Schädelvermessung wurde in den Niederlanden mit dem Ampelsystem entwickelt. Dort ist die Zucht verboten, wenn die relative Nasenverkürzung ein kraniofaziales Verhältnis von weniger als 0,3 aufweist. Das bedeutet, dass die Nasenlänge mindestens ⅓ der Gesamtkopflänge betragen muss.
BOAS (Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom)
Bei der Anamnese sollten klinische Symptome und die Vorgeschichte des Hundes berücksichtigt werden. Eine erste Beurteilung kann durch eine klinische Untersuchung vor und nach körperlicher Belastung erfolgen. Visuell können die Nasenlöcher und eine eventuell forcierte Atmung beurteilt werden.
Bei stabilen Patienten sollte zusätzlich die Lungenfunktion mittels Auskultation, Pulsoxymetrie und Blutgasanalyse überprüft werden. Allenfalls vorliegende Pneumonien und Lungenödeme können röntgenologisch diagnostiziert werden.
Zur Einschätzung des BOAS-Schweregrads kann ein Belastungstest (Cambridge Test) durchgeführt werden, der bei allen Tieren angezeigt ist, bei denen das kraniofaziale Verhältnis (CFR) auffällige Abweichungen ergibt – kann berechnet werden, indem die Nasenlänge (cm) durch die Schädellänge (cm) geteilt wird. Eine genauere Untersuchung der anatomischen Strukturen erfolgt mittels bildgebender Verfahren wie Röntgen, CT oder Endoskopie in Narkose.
Chiari Malformation/Syringomyelie
Schmerzen können durch klinische Anzeichen und Angaben aus der Anamnese festgestellt werden. Hundehalter*innen berichten, dass betroffene Hunde insbesondere nachts, beim ersten Aufstehen, bei extremer Hitze oder Kälte, bei Aufregung oder bei bestimmten Körperhaltungen verstärkte Symptome zeigen.
Die Schmerzsymptomatik reicht von leichter Überempfindlichkeit im Kopf- und Nackenbereich (Kopf- und Nackenhyperästhesie) bis hin zu plötzlichem Schreien bei Kopfbewegungen.
Achtung: Ein MRT ist nicht nur essentiell für die Diagnose, sondern eine Diagnose zum Vorliegen und Grad der Chiari Malformation / Syringomyelie ist nur über ein MRT möglich, wobei zur Durchführung jeweils aktuelle Standards einzuhalten sind. Dabei können auch zusätzliche Informationen zum Ventrikelsystem und beiden Mittelohren (PSOM oder Mittelohrerguss) gewonnen werden.
Zusätzliche bildgebende Verfahren wie Myelographie, Elektromyographie, periphere Nervenleitungs- und Amplitudenstudien sowie Technetium-99m-Knochenszintigraphie können, wenn zur Evaluation einer möglichen Therapie des Tieres erforderlich, die Diagnose weiter unterstützen.
Für bestimmte Fragestellungen kann ein Funktions-MRT oder Funktions-cine-MRT zur Diagnosefindung beitragen. Dabei werden wie bei einem kinematographischen Film („cine“) in schneller Folge Schnittbilder an derselben Stelle erzeugt.
Mitralklappenerkrankungen
Eine erste Verdachtsdiagnose kann durch Auskultation des Herzens gestellt werden. Die Echokardiographie ist das wichtigste Verfahren zur Diagnose von Herz- und Gefäßerkrankungen. Ergänzend können eine Blutdruckmessung sowie Röntgenaufnahmen zur Beurteilung des Herzschattens und möglicher Lungenveränderungen durchgeführt werden.
Je nach Risiko für eine Herzerkrankung kann ein Staging erfolgen. Die Speckle-Tracking-Echokardiographie (STE) ermöglicht eine genauere Beurteilung der Herzfunktion und liefert Hinweise darauf, ob eine bestehende Mitralklappeninsuffizienz fortschreitet und das Herz überlastet ist.
Augenerkrankungen
Erste Hinweise auf eine bestehende Beeinträchtigung/Veränderung z.B. des Tränen- Nasenkanals können durch bräunliche Fellverfärbungen auffallen. Es wird eine vollständige ophthalmologische Untersuchung durchgeführt, unter anderem inklusive Schirmer-Tränentest, Tonometrie, Ophthalmoskopie und weiteren diagnostischen Verfahren je nach Verdachtsdiagnose.
Congenitale Keratoconjunctivitis sicca und Ichthyosiforme Dermatose (CKCSID) – Dry Eye Curly Coat Syndrom
Verdachtsdiagnose aufgrund des typischen Erscheinungsbildes (bei Welpen von Geburt an) und der Rassenzugehörigkeit. Die Absicherung erfolgt durch die Durchführung einer gründlichen ophthalmologischen und dermatologischen Untersuchung und durch Gentest. Fehlende Hinweise auf eine andere Pathogenese (z.B. endokrine Erkrankung) sprechen ebenfalls für die Diagnose.
Chondrodysplasie und Chondrodystrophie inkl. Bandscheibenerkrankungen
Das äußere Erscheinungsbild und die Beobachtung der Tiere in Bewegung können adspektorisch beurteilt werden. Zur Beurteilung von häufig auftretenden Bandscheibenerkrankungen sind neben einer neurologischen Untersuchung und Einstufung der Klinik bildgebende Verfahren einzusetzen, wie z.B. CT (und Myelographie).
Degenerative Myelopathie
Die Verdachtsdiagnose kann auf der Grundlage der Symptome und Befunde der körperlichen Untersuchung gestellt werden, ergänzt durch Röntgenaufnahmen, MRT-Scan und/oder CT-Scan, um andere Erkrankungen auszuschließen. Eine definitive Diagnose kann jedoch nur durch postmortale histologische Untersuchungen oder/und einen Gentest gestellt werden.
Primary Secretory Otitis Media (PSOM)
Eine otoskopische Untersuchung ermöglicht die Beurteilung des Gehörgangs und des Trommelfells. Zur Absicherung und bei auffälligen Befunden kann Probenmaterial aus dem Ohrkanal zytologisch und mikrobiologisch untersucht werden. Bei Vorhandensein von neurologischen Symptomen ist eine neurologische Untersuchung zum Ausschluss anderer Erkrankungen vorzunehmen. Goldstandard und notwendig für eine definitive Diagnose sind CT-Aufnahmen, um die Gehörgänge und potenzielle Ergüsse beurteilen zu können. Auch ein MRT kann als Bildgebung genutzt werden. Für eine gesicherte Diagnose ist eine Myringotomie (Durchstechen des Trommelfells) vorzunehmen, um das charakteristische Material aus der Bulla tympanica zu sichten und zu entfernen. Aufgrund der ähnlichen Klinik sind differentialdiagnostisch vor allem Bandscheibenerkrankungen, entzündliche Ohrerkrankungen, entzündliche Erkrankungen des ZNS, Syringomyelie und Chiari-ähnliche Malformation auszuschließen.
Chronisch-Ulcerative Parodontale Stomatitis (CUPS)
Eine umfassende Untersuchung der Maulhöhle ist erforderlich. Diese gestaltet sich ohne Vollnarkose häufig schwierig, da die meisten betroffenen Hunde bei der Berührung der Mundschleimhaut erhebliche Schmerzen empfinden. Die Diagnose kann adspektorisch erfolgen, wenn die Schleimhautläsionen direkt an den freiliegenden Oberflächen der Zahnwurzeln mit Plaque- und Zahnsteinablagerungen in Kontakt stehen. In der Regel kann jedoch erst die histologische Analyse einer Biopsie die Verdachtsdiagnose bestätigen. In den Scheimhautläsionen sind typischerweise plasmatische und lymphozytäre Infiltrate zu finden. Zur Beurteilung des Parodontalstatus sollten Röntgenbilder angefertigt werden.
Episodic Falling Syndrome
Die Diagnose kann durch die Rassenzugehörigkeit adspektorisch während der “Anfälle” gestellt werden, da die Tiere charakteristische Symptome zeigen: Die fortschreitende Hypertonisierung der Vorder- und Hintergliedmaßen führt dazu, dass die Hunde schließlich in einer typischen „Gebetsstellung“ immobilisiert werden. Die Versteifung aller vier Gliedmaßen während körperlicher Aktivität kann zu einem Sturz führen, ohne dass es zu Bewusstseinsverlust oder Zyanose kommt. Weitere klinische Anzeichen können eine Steifheit der Gesichtsmuskulatur, Stolpern, ein Durchbiegen des Rückens oder Vokalisationen umfassen. Zur Absicherung der Diagnose kann ein Gentest durchgeführt werden.
8. Aus tierschutzfachlicher Sicht notwendige oder mögliche Anordnungen
Entscheidungen über Zucht- oder Ausstellungsverbote können im Zusammenhang mit der Belastungskategorie (BK) getroffen werden. Ausschlaggebend für ein Zuchtverbot kann je nach Ausprägung und Befund der schwerste, d.h. das Tier am meisten beeinträchtigende Befund und dessen Einordnung in eine der Belastungskategorien (BK) sein, oder auch die Zusammenhangsbeurteilung, wenn viele einzelne zuchtbedingte Defekte oder rassetypische Prädispositionen vorliegen. Zusätzlich sollten auch der individuelle Inzuchtkoeffizient des Tieres sowie dessen Trägereigenschaft für Risiko-Gene in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.
Generell sollte auch bei der Zucht von Cavalier King Charles Spaniel beachtet werden:
Neben zu beachtenden äußerlichen, anatomischen und funktionellen Merkmalen sowie des Verhaltens beider Zuchtpartner, sollten die Möglichkeiten zuchthygienischer Beratung auf molekulargenetischer Ebene genutzt werden und insbesondere der genetische Inzuchtkoeffizient, der Heterozygotiewert und die Dog Leukocyte Antigene (DLA) für die Rasse bestimmt werden. In zunehmendem Maß können auch sogenannte Matching Tools/Scores die Auswahl geeigneter Zuchtpartner erleichtern.
a) notwendig erscheinende Anordnungen
Ein Zuchtverbot gemäß § 11b TierSchG ist für Tiere mit vererblichen bzw. zuchtbedingten Defekten anzuordnen, insbesondere bei:
- Brachycephalie
- Vorliegen eines brachycephalen obstruktiven Atemwegssyndroms (BOAS)
- Syringomyelie/Chiari-ähnliche Malformation (MRT Befund zwingend erforderlich*)
- Herzerkrankungen
- Augenerkrankungen
*Technische Anforderungen an das MRT: kein Lowfield MRT! Genauere Angaben zur Stärke des Magnetfeldes (Standard:bei mind. 1,5 T ist die Auflösung ausreichend ) und empfohlenes Protokoll einer Syrinx Diagnostik, sowie empfohlene Reihenfolge & Schnittebenen, folgt.
Achtung: Die Anforderungen, die zu einem Zuchtverbot führen und den Voraussetzungen, die zu einem Ausstellungsverbot führen, können unterschiedlich beurteilt werden. Da sich im späteren Lebensalter immer noch eine Syrinx entwickeln kann, wären auch bei zunächst Syrinx freien Tieren mit einer Chiari Malformation, Nachuntersuchungen (MRT) im Abstand von mehreren Jahren erforderlich.
Ein Ausstellungsverbot gemäß § 10 TierSchHuV ist anzuordnen, wenn einer der oben genannten Defekte vorliegt. Für ein Ausstellungsverbot ist zunächst maßgeblich, ob ein sichtbarer oder verdeckter zuchtbedingter Defekt vorliegt, nicht jedoch dessen Grad oder Ausmaß. Die Chiari-Malformation (CM) bei Hunden wird als vererbbar angesehen, insbesondere bei bestimmten Rassen wie dem Cavalier King Charles Spaniel. Es handelt sich dabei um eine Fehlbildung des Schädels und des Gehirns, bei der die hintere Schädelgrube zu klein ist, was zu einer Kompression des Kleinhirns und zu Problemen mit dem Liquorfluss führen kann. Für eine Ausstellungserlaubnis ist ein MRT- Befund zum Ausschluss einer Chiari Malformation / Syringomyelie zwingend erforderlich. Die angeborene Fehlbildung des Schädels (Malformation) wird als Schaden bewertet, mit welchem ein Hund gemäß §10 TierSchHuV nicht ausgestellt werden darf.
b) mögliche Anordnungen
- Anordnung weiterführender Untersuchungen oder Gentests
- Anordnung zur dauerhaften Unfruchtbarmachung (Kastration) gemäß § 11b (2) TierSchG. Hinweis: Nur die chirurgische Kastration (Entfernung der Keimdrüsen (Hoden oder Ovarien)) ist als tierschutzgerechte Maßnahme anzuwenden. Eine Sterilisation oder längerfristige medikamentöse Unfruchtbarmachung kann mit nicht unerheblichen Nebenwirkungen behaftet sein.
Bitte beachten:
Entscheidungen über Anordnungen und Zuchtverbote sind immer im Einzelfall zu treffen. Sie liegen im Ermessen der zuständigen Behörde und müssen die aktuellen rechtlichen Vorgaben, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse sowie die vor Ort vorgefundenen Umstände berücksichtigen.
9. Allgemeine tierschutzrechtliche Bewertung
a) Deutschland
Aus tierschutzrechtlicher Sicht sind Hunde mit den oben beschriebenen Defekten/Syndromen in Deutschland gemäß § 11b TierSchG als Qualzucht einzuordnen.
Begründung:
Gem. §11b TierSchG ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht bei der Nachzucht oder den Nachkommen u.a.
Gem. § 11b TierSchG ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht bei der Nachzucht oder den Nachkommen u.a.
- erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 1 TierSchG) oder
- die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt (§ 11b Abs. 1 Nr. 2 c TierSchG).
Die „International Association for the Study of Pain“ (IASP) definiert Schmerzen als
„eine unangenehme sensorische und gefühlsmäßige Erfahrung, die mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigung verbunden ist oder dieser ähnelt (https://www.iasp-pain.org/wp-content/uploads/2022/04/revised-definition-flysheet_R2-1-1-1.pdf).
Schmerz definiert man beim Tier als unangenehme Sinneswahrnehmung, verursacht durch tatsächliche oder potentielle Verletzung, die motorische oder vegetative Reaktionen auslöst, in einem erlernten Vermeidungsverhalten resultiert und potentiell spezifische Verhaltensweisen verändern kann (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, TierSchG, Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 12 mwN; grds. auch Lorz/Metzger TierSchG 7. Aufl. § 1 Rn. 20).
Leiden sind alle nicht bereits vom Begriff des Schmerzes umfassten Beeinträchtigungen im Wohlbefinden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeitspanne fortdauern (Hirt/Maisack/Moritz/Felde Tierschutzgesetz Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 19 mwN.; Lorz/Metzger, TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 33 mwN). Auch Leiden können physisch wie psychisch beeinträchtigen; insbesondere Angst wird in der Kommentierung und Rechtsprechung als Leiden eingestuft (Hirt/Maisack/Moritz/Felde § 1 TierSchG Rn. 24 mwN; Lorz/Metzger § 1 TierSchG Rn. 37). Ein normales Verhalten ist ein Indiz für Wohlbefinden und Gesundheit; umgekehrt ist z.B. ein eingeschränktes Bewegungsverhalten ein Indiz für Störungen des Wohlbefindens und damit für Leiden (Hirt/Maisack/Moritz/Felde § 1 TierSchG Rn 20).
Ein Schaden liegt vor, wenn der körperliche oder seelische Zustand, in welchem ein Tier sich befindet, vorübergehend oder dauernd zum Schlechteren hin verändert wird (Hirt/Maisack/Moriz/Felde TierSchG Komm. 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 27 mwN; Lorz/Metzger TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 52 mwN), wobei völlig geringfügige Beeinträchtigungen, basierend auf körperlicher oder psychischer Grundlage, außer Betracht bleiben. „Der Sollzustand des Tieres beurteilt sich an Tieren der gleichen Art. Das Fehlen von Körperteilen wird dabei in der Kommentarliteratur regelmäßig als Schaden bewertet“ (VG Hamburg Beschl. v. 4.4.2018, 11 E 1067/18 Rn. 47, so auch Lorz/Metzger TierSchG Komm. § 1 Rn. 52).
Die Zucht des Cavalier King Charles Spaniels erfüllt bei Vorliegen der oben beschriebenen Defekte den Tatbestand der Qualzucht. Dies ergibt sich aus den unter Ziffer 5 im Detail erläuterten Schäden, Schmerzen und Leiden, insbesondere durch:
- Brachycephalie u.ggf. Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom (BOAS)
- Syringomyelie/Chiari-ähnliche Malformation
- Schäden am Skelettsystem (Kopf, Wirbelsäule, Gliedmaßen) und die damit ggf. verbundenen Schmerzen und Leiden
- Herzerkrankungen
- Episodic Falling Syndrome
- Augenerkrankungen sowie damit verbundene Schmerzen, Leiden oder Schäden
Dabei ist zu beachten, dass ein Zuchtverbot nicht nur dann greift, wenn mit Tieren gezüchtet wird, die selbst qualzuchtrelevante Merkmale aufweisen (Merkmalsträger), sondern auch dann, wenn bekannt ist oder bekannt sein muss, dass ein zur Zucht verwendetes Tier Merkmale vererben kann, die bei den Nachkommen zu einer der nachteiligen Veränderungen führen können (Anlageträger; insbesondere Tiere, die bereits geschädigte Nachkommen hervorgebracht haben; Lorz/Metzger, Kommentar zum TierSchG § 11b Rn. 6 mit weiterem Nachweis).
– Ein wichtiges Indiz für einen erblichen Defekt ist, dass eine Erkrankung oder Verhaltensabweichung bei verwandten Tieren häufiger auftritt als in der Gesamtpopulation der Tierart Hund. Gegen einen Schaden spricht nicht, dass sich die Rasse oder Population über längere Zeit als lebensfähig erwiesen hat (vgl. Lorz/Metzger Kommentar zum TierSchG § 11b Rn. 9).
– Das Verbot gilt unabhängig von der subjektiven Tatseite, also unabhängig davon, ob der Züchter selbst die Möglichkeit der schädigenden Folgen erkannt hat oder hätte erkennen müssen. Wegen dieses objektiven Sorgfaltsmaßstabes kann er sich nicht auf fehlende subjektive Kenntnisse oder Erfahrungen berufen, wenn man die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen von einem sorgfältigen Züchter der jeweiligen Tierart erwarten kann (vgl. Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, Kommentar, § 11b TierSchG Rn. 6).
– Vorhersehbar sind erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann, wenn ungewiss ist, ob sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen auftreten (vgl. Goetschel in Kluge § 11b Rn. 14).
Achtung: Unter Berücksichtigung deutscher Gesetzgebung (§11bTierSchG) ist eine Weiterzucht von Tieren mit den oben beschriebenen zuchtbedingten Defekten nicht zulässig, auch nicht mit dem Ziel diese Defekte heraus zu züchten (Outcross- Verfahren) !
b) Österreich
Hunde mit den o. beschriebenen Defekten/ Syndromen sind in Österreich gemäß §5 TSchG als Qualzucht einzuordnen
Gegen § 5 des österreichischen TschG verstößt insbesondere*, wer „ Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen“.
*Das Wort “insbesondere” bedeutet, dass die Liste nicht vollständig, sondern beispielhaft ist. Das bedeutet, dass auch andere als die in §5 aufgezählten Merkmale und Symptome, so sie zu zuchtbedingten Veränderungen, die mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sein können, führen, als Qualzuchtmerkmale gewertet werden.
Verkürzung des Gesichtsschädels: Die Zucht mit Hunden, die unter einer massiven Verkürzung des Gesichtsschädels und den damit verbundenen Problemen leiden oder dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn folgende in § 5 aufgezählte Symptome verwirklicht sind: Atemnot, Fehlbildungen des Gebisses.
In den Erläuterungen zum TSCHG (Novelle 2008),werden zu die aufgeführten Merkmale /Symptome und deren mögliche Folgen erläuternd erwähnt:
- zu lit a) Atemnot („Brachycephalensyndrom bei Hunden
- zu lit d) Entzündungen der Haut („als Folge von Hautfalten (…, brachycephale Rassen) …“)
- zu lit f) Entzündungen der Lidbindehaut und/oder der Hornhaut („… als Folge von Lidanomalien bei brachycephalen Rassen …“)
- zu lit j) Neurologische Symptome: („als Folge von Anomalien … der Wirbelsäule (… Blockwirbel bei brachycephalen Rassen …“)
- zu lit k) Fehlbildungen des Gebisses („im Zusammenhang mit Schädelanomalien bei brachycephalen Rassen“)
- zu lit m) Körperformen, bei denen mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden muss, dass natürliche Geburten nicht möglich sind („Verbreiterung der Schädelbasis bei gleichzeitiger Verengung des Beckenkanals bei brachycephalen Rassen …“)
Syringomyelie/Chiari-ähnliche Malformation: Die Zucht mit Hunden, bei denen eine Missbildung des Schädels in Form einer Chiari-ähnlichen Malformation und/oder eine Syringomyelie vorliegt oder die dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: neurologische Symptome.
Augenerkrankungen: Die Zucht mit Hunden, die unter pathologischen Veränderungen der Augen leiden oder die dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: Entzündungen der Lidbindehaut und/oder der Hornhaut, Blindheit.
Wirbelsäulenerkrankungen: Die Zucht mit Hunden, die unter Veränderungen der Wirbelsäule leiden oder dafür genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, wenn das folgende in § 5 aufgezählten Symptom verwirklicht ist: Bewegungsanomalien.
Herzerkrankungen: Die Zucht mit Hunden, die unter Herzerkrankungen leiden oder dazu genetisch prädestiniert sind, ist als Qualzucht zu qualifizieren, da wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit bzw. physiologische Lebensläufe verwirklicht sind.
c) Schweiz
Wer mit einem Tier züchten will, das ein Merkmal oder Symptom aufweist, das im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu einer mittleren oder starken Belastung führen kann, muss vorgängig eine Belastungsbeurteilung vornehmen lassen. Bei der Belastungsbeurteilung werden nur erblich bedingte Belastungen berücksichtigt (vgl. Art. 5 Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten (TSchZV). Hunde mit Defekten, die der Belastungskategorie 3 zuzuordnen sind, unterliegen gemäß Art. 9 TSchZV einem Zuchtverbot. Ebenso ist es verboten mit Tieren zu züchten, wenn das Zuchtziel bei den Nachkommen eine Belastung der Kategorie 3 zur Folge hat. Mit Tieren der Belastungskategorie 2 darf gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt (Art. 6 TSchZV). Anhang 2 der TSchZV nennt Merkmale und Symptome, die im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu mittleren oder starken Belastungen führen können. Skelettdeformationen oder Fehlbildungen, wie Bewegungsanomalien oder Lähmungen, degenerative Gelenkveränderungen, Bandscheibenvorfälle, Schädeldeformationen mit behindernden Auswirkungen auf die Atemfähigkeit, die Lage der Augen, die Zahnstellung, Fehlfunktionen und Missbildungen der Augen, Katarakt, progressive Retinaatrophie (PRA), Verlagerungen des Augapfels, Fehlfunktionen des Hörapparates, Orientierungsverluste durch Innenohrdefekte sowie Koordinations- oder Bewegungsstörungen werden ausdrücklich erwähnt.
Zudem werden gemäß Art. 10 TSchZV einzelne Zuchtformen ausdrücklich verboten. In den übrigen Fällen wird ein Zuchtverbot jedoch nur im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung ausgesprochen. Tiere, die aufgrund unzulässiger Zuchtziele gezüchtet wurden, dürfen nicht ausgestellt werden (Art. 30a Abs. 4 Bst. b TSchV).
d) Niederlande
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” des Tierhalter-Dekrets verboten, mit Haustieren in einer Weise zu züchten, die dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Elterntiere oder ihrer Nachkommen abträglich ist.
In jedem Fall muss die Zucht so weit wie möglich verhindern, dass
- schwerwiegende Erbfehler und Krankheiten an die Nachkommen weitergegeben werden oder bei ihnen auftreten können;
- äußere Merkmale an die Nachkommen weitergegeben werden oder sich bei ihnen entwickeln können, die schädliche Folgen für das Wohlbefinden oder die Gesundheit der Tiere haben.
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” und Artikel 2 “Zucht mit brachyzephalen Hunden” des Tierhalter-Dekrets verboten, Hunde zu züchten, deren Schnauze kürzer als ein Drittel der Schädellänge ist.
Folgende Erbkrankheiten oder Anomalien gemäß Artikel 3.4. sind beim Cavalier King Charles Spaniel verwirklicht: Brachycephalie, Erkrankungen des Auges, Anomalien der Wirbelsäule, Herzerkrankungen, Chiari-ähnliche Malformation des Kopfes.
e) Norwegen
Beschränkung der Zucht durch Vorgaben und angeordnete Evaluierung der Wirksamkeit der Maßnahmen. Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofes in Norwegen ist die Zucht von reinrassigen Cavalier King Charles Spaniels in der bisherigen Form aufgrund von Krankheiten und Inzucht verboten. Dies gilt bisher nicht für Kreuzungen.
Der Oberste Gerichtshof hat den English Toy Spaniel/King Charles Spaniel nicht berücksichtigt, so dass sich das Urteil auf die Rasse Cavalier King Charles Spaniel bezieht.
Erste Evaluierungen nach einem Jahr ergaben, dass das Zuchtverbot für reinrassige Cavalier King Carles Spaniel auf die restliche Hundezucht in Norwegen bisher keinerlei Einfluss gehabt hat.
Ausführliche rechtliche Bewertungen und/ oder Gutachten können, soweit schon vorhanden, auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden.
10. Relevante Rechtsprechung
- Deutschland: Nicht zu Cavalier King Charles Spaniel, aber zu Brachycephalie beim French Bulldog: VG Stade, Beschluss v. 07.07. 2022, 10 B 481/22 und OVG Lüneburg, Beschluss v. 25.10.2022, 11 ME 221722
- Österreich: LVwG Oberösterreich v. 06.11.23 – LVwG-000544/100/SB, Strafbefehl mit Kontext zu Brachycephalie
- Schweiz: Nicht bekannt.
- Niederlande: Gericht für Zivilrecht Amsterdam, Urteil vom 4.Juni 2025, Verbot der Ausstellung von Ahnentafeln für brachycephale Rassen
- Schweden: Nicht bekannt
- Norwegen: Das Dom Høyesterett als oberstes Berufungsgericht hat am 10.10.2023 festgestellt, dass der Cavalier King Charles Spaniel aufgrund der Vielzahl an schwerwiegenden Erkrankungen – allein bereits aufgrund der Chiari-like Malformation (CM) und der Syringomyelie (SM) – als Qualzucht einzustufen ist (HR-2023-1901-A AZ 23-004643SIV-HRET).
11. Anordnungsbeispiel vorhanden?
Nein.
Anordnungsbeispiele werden ausschließlich auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt.
12. Zuwendungen Förderungen
13. Literaturverzeichnis/ Referenzen/ Links
An dieser Stelle wird nur eine Auswahl an Quellen zu den oben beschriebenen Defekten und ggf. allgemeine Literatur zu zuchtbedingten Defekten bei Hunden angegeben. Umfangreichere Literaturlisten zum wissenschaftlichen Hintergrund werden auf Anfrage von Veterinärämtern ausschließlich an diese versendet.
Hinweis: Die Beschreibung von mit dem Merkmal verbundenen Gesundheitsproblemen, für die bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, erfolgen vor dem Hintergrund entsprechender Erfahrungen der Experten und Expertinnen aus der tierärztlichen Praxis, und/oder universitären Einrichtungen, sowie öffentlich frei einsehbaren Datenbanken oder Veröffentlichungen von Tier-Versicherungen und entstammen daher unterschiedlichen Evidenzklassen.
Da Zucht und Ausstellungswesen heutzutage international sind, beziehen sich die Angaben in der Regel nicht nur auf Prävalenzen von Defekten oder Merkmalen in einzelnen Verbänden, Vereinen oder Ländern.
Quellen:
AGRIA Pet Insurance Sweden. (2021). Cavalier King Charles Spaniel Agria Breed Profiles Veterinary Care 2016-2021.
Anderson, J. G., Peralta, S., Kol, A., Kass, P. H., & Murphy, B. (2017). Clinical and Histopathologic Characterization of Canine Chronic Ulcerative Stomatitis. Veterinary Pathology, 54(3), 511–519. https://doi.org/10.1177/0300985816688754
Anderson, J. G., Paster, B. J., Korakas, A., Chen, T., & New England Bio Labs, England. (2021). Characterization of the Oral Microbiome in Canine Chronic Ulcerative Stomatitis. Journal of Immune Research, 7(1). https://doi.org/10.26420/jimmunres.2021.1037
Beckers, E., Van Poucke, M., Ronsyn, L., & Peelman, L. (2016). Frequency estimation of disease-causing mutations in the Belgian population of some dog breeds—Part 2: Retrievers and other breed types. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 85(4). https://doi.org/10.21825/vdt.v85i4.16328
Borgarelli, M., & Haggstrom, J. (2010). Canine Degenerative Myxomatous Mitral Valve Disease: Natural History, Clinical Presentation and Therapy. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 40(4), 651–663. https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2010.03.008
British Veterinary Association and The Kennel Club. (2019). Chiari Malformation / Syringomyelia Scheme. Canine Health Schemes. https://www.bva.co.uk/media/2800/20190710-chs-cmsm-leaflet-0719-v1-web.pdf
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. (2015). Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/747/de
Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (TSchG) Österreich (2005).
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541
Cavalier-King-Charles-Spaniel Club Deutschland e.V. (2015). Zuchtordnung. https://ccd-cavaliere.de/dokument/Zuchtordnung_2019_1572261383_6250.pdf
Cerda‐Gonzalez, S., Olby, N. J., McCullough, S., Pease, A. P., Broadstone, R., & Osborne, J. A. (2009). Morphology of the caudal fossa in Cavalier King Charles spaniels. Veterinary Radiology & Ultrasound, 50(1), 37–46. https://doi.org/10.1111/j.1740-8261.2008.01487.x
Cerda-Gonzalez, S., Bibi, K. F., Gifford, A. T., Mudrak, E. L., & Scrivani, P. V. (2016). Magnetic resonance imaging-based measures of atlas position: Relationship to canine atlantooccipital overlapping, syringomyelia and clinical signs. The Veterinary Journal, 209, 133–138. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2016.01.008
Cirsovius, T. (2021). Sind tierschutzwidrige Maßnahmen i. S. v. § 11b Abs. 1 TierSchG legal, wenn bezweckt ist, nach mehreren Zuchtgenerationen ungeschädigte, schmerz- und leidensfrei lebensfähige Nachkommen zu erzielen? https://qualzucht-datenbank.eu/gutachten-tieraerztekammer-berlin-weitere-informationen/
Geiger, M., Schoenebeck, J. J., Schneider, R. A., Schmidt, M. J., Fischer, M. S., & Sánchez-Villagra, M. R. (2021). Exceptional Changes in Skeletal Anatomy under Domestication: The Case of Brachycephaly. Integrative Organismal Biology, 3(1), obab023. https://doi.org/10.1093/iob/obab023
Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists, (ACVO). (2023). ACVO 2023 The Blue Book—Ocular disorders presumed to be inherited in purebreed dogs (15th Edition). https://ofa.org/wp-content/uploads/2024/05/ACVO-Blue-Book-2023.pdf
Hagen, M. A. E. van. (2019). Züchten mit kurzschnäuzigen Hunden. Übersetzung aus dem Niederländischen. https://www.uu.nl/sites/default/files/de_zuchten_mit_kurzschnauzigen_hunden_-_kriterien_zur_durchsetzing_-_ubersetzung_aus_dem_niederlandischen.pdf
Hale, F. (2008). Focus on: Chronic Ulcerative Paradental Stomatitis aka CUPS. Hale Veterinary Clinic. https://www.haleveterinaryclinic.ca/site/educational-material-veterinary-guelph/2024/03/21/cups
Hale, F. A. (2021). Dental and Oral Health for the Brachycephalic Companion Animal . In Health and Welfare of Brachycephalic (Flat-faced) Companion Animals (1., S. 235–250). Taylor and Francis Group. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429263231-14/dental-oral-health-brachycephalic-companion-animal-fraser-hale
Hustoft, E. (2014). Illegal dog breeding continues one year after Supreme Court verdict. Dyrebeskyttelsen Norge (The Norwegian Society for Protection of Animals). https://www.dyrebeskyttelsen.no/2024/10/10/illegal-dog-breeding-continues-one-year-after-supreme-court-verdict/
Knowler, S. P., Galea, G. L., & Rusbridge, C. (2018). Morphogenesis of Canine Chiari Malformation and Secondary Syringomyelia: Disorders of Cerebrospinal Fluid Circulation. Frontiers in Veterinary Science, 5, 171. https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00171
Limpens, C., Smits, V. T. M., Fieten, H., & Mandigers, P. J. J. (2024). The effect of MRI-based screening and selection on the prevalence of syringomyelia in the Dutch and Danish Cavalier King Charles Spaniels. Frontiers in Veterinary Science, 11, 1326621. https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1326621
Niederländischer Staatssekretär für Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovation vom 19. Oktober 2012, Nr. 291872, Direktion für Gesetzgebung und Rechtsfragen. (2024). Niederländisches Tierhalter-Dekret. Tierhalter Dekret. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2024-07-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel3.4
Niederländische Grundsatzregelung für brachycephale Rassen (2023). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2023-23619.pdf
Nimmo, J. S., McMillan, E., & Sofronidis, G. (2020). Congenital keratoconjunctivitis sicca and ichthyosiform dermatosis in a Cavalier King Charles spaniel with a single defective copy of the FAM83H gene. Australian Veterinary Practitioner, 50 (1), 41–45.
https://www.researchgate.net/publication/340810009_Intramedullary_spinal_cryptococcoma_lesion_in_a_dog_diagnosed
_by_magnetic_resonance_imaging_cerebrospinal_fluid_cytology_and_real-time_PCR_assay#page=43
O′Neill, D. G., Church, D. B., McGreevy, P. D., Thomson, P. C., & Brodbelt, D. C. (2014). Prevalence of Disorders Recorded in Dogs Attending Primary-Care Veterinary Practices in England. PLoS ONE, 9(3), e90501. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090501
O’Neill, D. G., Lee, M. M., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Sanchez, R. F. (2017). Corneal ulcerative disease in dogs under primary veterinary care in England: Epidemiology and clinical management. Canine Genetics and Epidemiology, 4(1), 5. https://doi.org/10.1186/s40575-017-0045-5
O’Neill, D. G., Pegram, C., Crocker, P., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Packer, R. M. A. (2020). Unravelling the health status of brachycephalic dogs in the UK using multivariable analysis. Scientific Reports, 10(1), 17251. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73088-y
O’Neill, D. G., Mitchell, C. E., Humphrey, J., Church, D. B., Brodbelt, D. C., & Pegram, C. (2021). Epidemiology of periodontal disease in dogs in the UK primary‐care veterinary setting. Journal of Small Animal Practice, 62(12), 1051–1061. https://doi.org/10.1111/jsap.13405
Orthopedic Foundation for Animals (OFA). (2025). Cavalier King Charles Spaniel Testing Statistics. https://ofa.org/chic-programs/browse-by-breed/?breed=KCS
Packer, R. M. A., Hendricks, A., Tivers, M. S., & Burn, C. C. (2015). Impact of Facial Conformation on Canine Health: Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. PLOS ONE, 10(10), e0137496. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137496
Schweizerischer Bundesrat. (2024). Tierschutzverordnung (TSchV) Schweiz. FedLex. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/de
Summers, J. F., O’Neill, D. G., Church, D. B., Thomson, P. C., McGreevy, P. D., & Brodbelt, D. C. (2015). Prevalence of disorders recorded in Cavalier King Charles Spaniels attending primary-care veterinary practices in England. Canine Genetics and Epidemiology, 2(1), 4.
https://doi.org/10.1186/s40575-015-0016-7
Summers, J. F., O’Neill, D. G., Church, D., Collins, L., Sargan, D., & Brodbelt, D. C. (2019). Health-related welfare prioritisation of canine disorders using electronic health records in primary care practice in the UK. BMC Veterinary Research, 15(1), 163. https://doi.org/10.1186/s12917-019-1902-0
Verband für das Deutsche Hundewesen. (2023). Welpenstatistik. https://www.vdh.de/ueber-den-vdh/welpenstatistik/
Zeng, R., Coates, J. R., Johnson, G. C., Hansen, L., Awano, T., Kolicheski, A., Ivansson, E., Perloski, M., Lindblad‐Toh, K., O’Brien, D. P., Guo, J., Katz, M. L., & Johnson, G. S. (2014). Breed Distribution of SOD 1 Alleles Previously Associated with Canine Degenerative Myelopathy. Journal of Veterinary Internal Medicine, 28(2), 515–521. https://doi.org/10.1111/jvim.12317
Dieses Merkblatt wurde durch die QUEN gGmbH unter den Bedingungen der „Creative Commons – Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ – Lizenz, in Version 4.0, abgekürzt „CC BY-NC-SA 4,0“, veröffentlicht. Es darf entsprechend dieser weiterverwendet werden, Eine Kopie der Lizenz ist unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ einsehbar. Für eine von den Bedingungen abweichende Nutzung wird die Zustimmung des Rechteinhabers benötigt.
Sie können diese Seite hier in eine PDF-Datei umwandeln: