Tierart: Hund
Rasse: Shih Tzu
QUEN-Merkblatt Nr. 36
Bearbeitungsstand: 17.07.2025
Tierart: Hund
Rasse: Shih Tzu
QUEN-Merkblatt Nr. 36
Bearbeitungsstand: 17.07.2025
1. Beschreibung der Tiere
FCI Rassestandard* Nr.: 208
Äußeres Erscheinungsbild und laut Standard geforderte, kritische Merkmale:
Hunde der Rasse Shih Tzu sind laut Rassestandard reichlich behaart. Der Kopf ist breit und rund. Das Haar wächst nach oben auf dem Fang. Der Fang ist quadratisch, kurz und flach. Die Oberkante des Nasenschwamms ist in gleicher Höhe oder wenig tiefer als die unteren Lidränder. Der Shih Tzu weist einen knappen Vorbiss oder ein Zangengebiss auf. Die Augen sollen groß, dunkel und rund sein. Die Ohren sind groß und hängend mit langem Ohrleder und dicht mit Haaren bedeckt. Die Gliedmaßen sind kurz.
Laut Welpenstatistik des VDH wurden im Jahr 2023 in den dem VDH angeschlossenen Vereinen 104 Welpen dieser Rasse gezüchtet.
*Rassestandards und Zuchtordnungen haben im Gegensatz zu TierSchG und TierSchHuV keine rechtliche Bindungswirkung.
2.1 Bild 1

Shih Tzu.
Foto: danny O. – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2200696
2.1 Bild 2

Shih Tzu. Foto: Mostafameraji -CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121181411
Weitere Fotos finden Sie hier (Bild anklicken):
3. In der Rasse häufig vorkommende Probleme/Syndrome
Von mehreren in dieser Rasse vorkommenden Problemen und möglicherweise auftretenden Erkrankungen werden an dieser Stelle nur die wichtigsten bei dieser Rasse auftretenden Defekte aufgeführt.
Beim Shih Tzu sind folgende rassetypische Defekte oder gehäuft vorkommende Probleme/ Gesundheitsstörungen und Dispositionen* bekannt:
- Brachycephalie
- BOAS (Brachycephales Obstruktives Atemwegssyndrom)
- Augenerkrankungen
- Chondrodystrophie und Chondrodysplasie inkl. Bandscheibenerkrankungen (IVDD)
- Herzklappenerkrankungen
- Gebiss- und Zahnfehlstellungen sowie Erkrankungen des Zahnhalteapparats
* (bitte dazu auch die bereits vorhandenen Merkblätter zu einzelnen Defekten wie insbesondere Merkblatt Nr. 8 Hund Brachycephalie und Merkblatt Nr. 11 Hund Entropium sowie ggf. Merkblätter zu Rassen, die historisch an der Entstehung der Rasse beteiligt waren, in diesem Fall Merkblatt Nr. 30 Hund Pekingese, beachten).
4. Weitere ggf. gehäuft auftretende Probleme
In der veterinärmedizinischen Fachliteratur finden sich neben den unter Punkt 3 angegebenen rassetypischen Defekten Hinweise zum Vorkommen folgender Probleme, die nachfolgend nicht weiter ausgeführt werden, da noch keine abschließenden Schlussfolgerungen aus den bekannt gewordenen Prävalenzen gezogen werden können und durch Züchter, Zuchtvereine und -verbände keine unter wissenschaftlichen Kautelen erhobenen Prävalenzen angegeben werden. Für diese Fälle ist jedoch die folgende Aussage von Hale (2021) zutreffend: “The absence of evidence is not the evidence of absence”.
- Analbeutelerkrankungen
- Atlantoaxiale Subluxation/Instabilität
- Chronische hypertrophe Pylorusgastropathie
- Demodikose
- Dermoid Sinus
- Eklampsie (puerperale Tetanie)
- Epilepsie
- Geburtsschwierigkeiten (Dystokie)
- Glaskörpererkrankungen
- Hämophilie A und B, Von-Willebrand-Erkrankung
- Hüftdysplasie
- Hypertrophe Kardiomyopathie
- Hypoplasie der Pfortader
- Kongenitaler portosystemischer Shunt
- Kryptorchismus
- Lippen-/Gaumenspalte
- Mastzelltumor
- Malassezia-Dermatitis
- Maulschleimhautwucherungen (Epulis)
- Nekrotisierende Meningoenzephalitis
- Nickhautvorfall (“cherry eye”)
- Nierenerkrankungen
- Nierensteine
- Okuläre Dermoide
- Panostitis
- Patellaluxation
- Retinadysplasie
- Trachealkollaps
- Urolithiasis
- Pyodermie
- Legg-Calvé-Perthes-Erkrankung
5. Symptomatik und Krankheitswert einiger Defekte: Bedeutung/Auswirkungen des Defektes auf das physische/ psychische Wohlbefinden (Belastung) des Einzeltieres u. Einordnung in Belastungskategorie∗
*Die einzelnen zuchtbedingten Defekte werden je nach Ausprägungsgrad unterschiedlichen Belastungskategorien (BK) zugeordnet. Die Gesamt-Belastungskategorie richtet sich dabei nach dem jeweils schwersten am Einzeltier festgestellten Defekt. Das hier verwendete BK-System als Weiterentwicklung nach dem Vorbild der Schweiz (das bedeutet, die Beurteilung kann von der Einteilung in der Schweiz abweichen) ist noch im Aufbau und ist das Ergebnis tierschutzfachlicher Beurteilung. Daher sind die hier vorgenommenen BK-Werte als vorläufig anzusehen und bieten bis zu einer angestrebten länderübergreifenden Definition eine Unterstützung zur ersten Orientierung. So werden z.B. Funktionseinschränkungen von Sinnesorganen je nach Ausprägung der Belastungskategorie 2-3 zugeordnet.
In der Schweiz werden die Belastungen, die durch Zuchtmerkmale entstehen können, in 4 Kategorien eingeteilt (Art. 3 TSchZV, Schweiz). Für die Zuordnung eines Tieres zu einer Belastungskategorie ist das am stärksten belastende Merkmal oder Symptom entscheidend (Art. 4 TSchZV, Schweiz).
Kategorie 0 (keine Belastung): Mit diesen Tieren darf gezüchtet werden.
Kategorie 1 (leichte Belastung): Eine leichte Belastung liegt vor, wenn eine belastende Ausprägung von Merkmalen und Symptomen bei Heim- und Nutztieren durch geeignete Pflege, Haltung oder Fütterung, ohne Eingriffe am Tier und ohne regelmäßige medizinische Pflegemaßnahmen kompensiert werden kann.
Kategorie 2 (mittlere Belastung): Mit diesen Tieren darf ggf. nur gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt.
Kategorie 3 (starke Belastung): Mit diesen Tieren darf nicht gezüchtet werden.
Anmerkung vorab zu den bei dieser Rasse möglicherweise festgestellten zuchtbedingten Defekten: Zucht- und Ausstellungswesen sind heute international. Da keine belastbaren Prävalenzen zu Defektmerkmalen durch Züchter, Zuchtvereine und -verbände vorgelegt werden, wird die verfügbare internationale wissenschaftliche Literatur ausgewertet.
Brachycephalie (siehe auch Merkblatt Nr. 8 Hund Brachycephalie)
Physisch:
Die zuchtbedingten Veränderungen des Schädels, die mit der Brachycephalie einhergehen, fassen Geiger et al. (2021) in ihrer ausführlichen Übersicht zusammen. Charakteristisch ist der kurze und runde Schädel mit einer flachen Schnauze und kurzen Nase. Die Gehirnentwicklung ist von der Verkürzung des Schädels ebenfalls beeinflusst. Weitere Auffälligkeiten und Erkrankungen können direkt mit der Brachycephalie und der extremen Schädelform in Verbindung gebracht werden, wie Erkrankungen der oberen Atemwege (BOAS, siehe dort) oder Hornhautulzera (siehe Augenerkrankungen). In einer Studie aus Großbritannien mit über 22.000 Hunden war der Shih Tzu mit 19,07 % unter den brachycephalen Rassen vertreten und wurde damit als eine der häufigsten brachycephalen Hunderassen identifiziert. Verglichen mit nicht-brachycephalen Rassen weisen brachycephale Hunde einen insgesamt schlechteren Gesundheitszustand auf.
Der verkürzte Schädel kann Hautfalten im Bereich des Kopfes begünstigen, die von verschiedenen Krankheitserregern wie Bakterien, Hefen etc. besiedelt werden und zu entzündlichen Veränderungen führen. Geiger et al. (2021) und weitere Autoren verdeutlichen in ihren Zusammenfassungen auch die Folgen für das Gebiss durch die knöchernen Veränderungen des Schädels. Zahnfehlstellungen und andere Auffälligkeiten der Zähne sind auf den durch Brachycephalie und Kleinwuchs bedingten Platzmangel zurückzuführen. Häufig ist der Tränennasengang bei brachycephalen Rassen durch die zuchtbedingte Veränderung des Gesichtsschädels missgebildet und in seinem Verlauf stark abweichend. Er ist oft in der Länge erheblich reduziert und kann eine starke Steilstellung aufweisen. Der Abflussweg der Tränenflüssigkeit kann verändert sein. Dies führt zu einer teilweisen oder völligen Verlegung des Kanals, so dass Tränenflüssigkeit nach außen (über die Augen) abläuft. Ein Hinweis auf diesen Defekt ist eine „Tränenstraße“ mit bräunlicher Verfärbung des Fells, die bei gleichzeitigem Verlauf in einer Falte nicht selten zu einer Dermatitis führt.
Psychisch:
Im Vergleich zu Rassen ohne extreme Schädelform scheinen brachycephale Rassen, zu denen auch der Shih Tzu gehört, deutlich häufiger von verschiedenen Erkrankungen betroffen zu sein. Die mit der Brachycephalie einhergehenden Änderungen der anatomischen und physiologischen Verhältnisse führen zu Beeinträchtigungen wesentlicher Lebensbereiche wie Atmung, Schlaf, Futteraufnahme, Spiel, Temperaturregulation und Belastbarkeit und damit zu einer Verminderung der Lebensqualität der betroffenen Hunde. Es kann bei der Futteraufnahme zu Atemnot kommen. Betroffene Tiere benötigen meist bereits nach kurzen aktiven Phasen eine längere Erholungsphase. Das Spielen mit Artgenossen kann eingeschränkt sein. Die mit der Schädelveränderung einhergehende abgeflachte Orbita und das häufig bestehende Macroblepharon können auch beim Shih Tzu häufig zu hervorstehenden Augen führen (Exopthalmus), nicht selten auch verbunden mit einem Strabismus (Schielen), welches den Visus des Tieres nicht unwesentlich beeinträchtigt.
Belastungskategorie: 3
Brachycephales Obstruktives Atemwegssyndrom (BOAS)
Physisch:
Der Shih Tzu gehört zu den Rassen, bei denen das Brachycephale Obstruktive Atemwegssyndrom (BOAS) auftritt. Ursächlich sind die morphologischen Veränderungen, die mit der Brachycephalie einhergehen. Primäre Veränderungen beinhalten stenotische Nasenlöcher sowie eine Verdickung und Verlängerung des weichen Gaumens. Der Raum bzw. das Volumen des Nasopharynx ist hingegen signifikant verkleinert. Die Schleimhaut der Conchen hypertrophiert und behindert die Atmung zusätzlich. Die oberen Atemwege werden durch eine Hypertrophie der Schleimhaut in der Nasenmuschel und der Mukosa-Kontaktpunkte (mucosal contact points) verengt, die den Lufttransport einschränken und die Atemprobleme verstärken. Aufgrund der genannten anatomischen Veränderungen weisen brachycephale Hunde einen deutlich erhöhten Atemwiderstand auf, gegen den sie atmen müssen. Der intraluminale Druck ist während der Inspiration erhöht und ist ursächlich für sekundäre Anomalien, wie Entzündungen, evertierte Kehlkopftaschen und ggf. einen Larynx- sowie Trachealkollaps.
Ebenso können die unteren Atemwege betroffen sein. Veränderungen und Kollaps der Bronchien sowie Aspirationspneumonien treten gehäuft bei brachycephalen Rassen auf.
Eine Thermoregulation über die Verdunstung (Wärmeableitung über die Nasenschleimhaut) ist aufgrund der anatomischen Veränderungen kaum oder nur eingeschränkt möglich. In der Folge kann es zu Überhitzung des Tieres kommen, da durch die Veränderungen am Gaumen bzw. Nasopharynx auch das Hecheln stark beeinträchtigt sein kann.
Klinisch zeigen die Hunde Symptome im Bereich der oberen Atemwege, wie Stertor, Schnarchen sowie Aktivitätsintoleranz und Synkopen. Zu den gastrointestinalen Symptomen gehören vermehrtes Speicheln, Regurgitieren und Erbrechen. Auch eine verlängerte Transitzeit der Nahrung sowie häufig ein gastro-ösophagealer Reflux bei BOAS bzw. brachycephalen Tieren kann auftreten. Dieser Zustand beeinträcht das Wohlbefinden betroffener Tiere erheblich.
Psychisch:
Die physiologische Atmung ist bei betroffenen Tieren stark beeinträchtigt, sodass diese häufig an Dyspnoe bzw. respiratorischem Distress leiden. Diese Tiere leiden an chronischer Atemnot und sind gezwungen, größtenteils durch das geöffnete Maul zu atmen, obwohl der Hund eigentlich zu den obligaten Nasenatmern gehört. Vor allem bei hohen Außentemperaturen ist die Aktivität der Tiere aufgrund der beeinträchtigten Thermoregulation besonders eingeschränkt. Eine Bewegungs- und Hitzeintoleranz schränkt die Hunde enorm in ihrem arttypischen Verhalten ein. Allgemein wird für brachycephale Rassen beschrieben, dass betroffene Hunde unter Schlafapnoe, unruhigem Schlaf und Änderungen im Schlafverhalten leiden, die sich z.B. in der Einnahme von aufrechten Schlafpositionen oder Schlafen mit einem Gegenstand im Maul, um eine Obstruktion der Atemwege zu verhindern, äußert. Ein artgerechtes Leben und die Ausübung des arteigenen Verhaltens ist für betroffene Hunde kaum noch möglich.
Anmerkung: Entgegen der verbreiteten Überzeugung, dass eine nur mäßige Einschränkung der Atemfunktion (z.B. Cambridge-Test Ergebnis Grad 1) für das Tier eine Zucht- oder Ausstellungseignung begründen würde, ist diese Einschätzung aus medizinischer Sicht nicht nachvollziehbar, da es sich um einen durch anatomische Veränderung verursachten krankhaften Befund, mit einem in der Regel progressiven Verlauf handelt.
Belastungskategorie: 3
Augenerkrankungen
Physisch:
Brachycephale Rassen wie der Shih Tzu weisen anatomische Schädelveränderungen auf, die für verschiedene Erkrankungen der Augen verantwortlich gemacht werden. Sie werden als Brachycephales Okulares Syndrom (BOS) bezeichnet. Zusammen mit dem Brachycephalen Obstruktiven Atemwegssyndrom (BOAS) ist dies ein Teil des Brachycephalen Syndromkomplexes (Brachycephalic Syndrome Complex). Der übermäßige Selektionsdruck auf das gewünschte Aussehen kann zu diesen extremen Schädelformen führen. Zusätzlich kann das Sehvermögen der Hunde durch eine veränderte Sehachse (Schielen) eingeschränkt sein.
Der Shih Tzu gehört zu den Rassen, die für das BOS prädisponiert sind. Die folgenden Augenerkrankungen treten beim Shih Tzu am häufigsten auf: Keratokonjunktivitis sicca, Hornhautulcera, Hornhautpigmentierung, Distichiasis, Glaukom, Trichiasis, reduzierte Tränenproduktion, Entropium, Lagophthalmus und Katarakt. Die Krankheitsbilder ergeben sich bei der Rasse als Folgen der brachycephalen Anatomie und einer veränderten Qualität des Tränenfilms.
Beim Shih Tzu wird von einer Prädisposition für einen Katarakt ausgegangen. Ein Katarakt kann zu Einschränkungen des Visus führen. In einer Studie aus Nordamerika über einen Zeitraum von fast 40 Jahren gehörte der Shih Tzu zu den häufigsten Rassen, die mit einem primären Katarakt vorstellig wurden. Die Prävalenz lag bei 4,14 %. Bei Mischlingshunden lag sie bei lediglich 1,61 %. Mit einem Anteil von 16,9 % befand sich der Shih Tzu an dritter Stelle der häufigsten Rassen in einer retrospektiven Auswertung zur Diagnose Katarakt einer Universitätsklinik in Seoul. Das Risiko für die Erkrankung schien hier im Vergleich zu anderen Rassen allerdings nicht erhöht zu sein (OR: 0,9).
Der Shih Tzu gehört zu den Hunderassen, bei denen vermehrt ein primäres Glaukom festgestellt wird. In einer japanischen Studie waren 16,5% der betroffenen Hunde Shih Tzus. Die höchste Inzidenz zeigt sich im Alter von 7-8 Jahren. Insbesondere nach einer Katarakt-Operation (Phakoemulsifikation) besteht ein erhöhtes Risiko, ein Glaukom zu entwickeln. Bei einer Auswertung der rassenassoziierten Häufigkeit einer Enukleation des Auges wegen Glaukoms nach Katarakt-OP, waren Shih Tzus mit 5,8 % vertreten. Ein Glaukom wird bei einem Augeninnendruck von über 30 mmHg diagnostiziert. 24 % der Shih Tzus entwickeln ein Glaukom in mindestens einem Auge. Klinisch äußert sich das Glaukom unter anderem durch Mydriasis, Hornhautödem, Buphthalmus, retinale Hyperreflexivität, okuläre Schmerzen und reduzierten oder vollständigen Verlust des Sehvermögens.
Der Shih Tzu hatte in einer retrospektiven Studie im Vergleich zur Referenzpopulation ein ca. 45-fach erhöhtes Risiko an bakterieller Keratitis zu erkranken und war mit 20 % eine der am häufigsten von bakterieller Keratitis betroffenen brachycephalen Rassen. Es wird davon ausgegangen, dass die protektiven Mechanismen des Auges bei brachycephalen Rassen beeinträchtigt sind und beispielsweise ein Exophthalmus, Hautfalten und ein Entropium die Entstehung von bakteriellen Keratitiden begünstigen. Am häufigsten werden S. intermedius, β-hämolytische Streptococcus spp. und P. aeruginosa isoliert. Ein prädisponierender Faktor für Hornhautulcera bei Hunden mit bakterieller Keratitis scheint die Brachycephalie zu sein. 81 % der untersuchten Fälle mit Ulcerationen wiesen dieses Merkmal auf.
Auch einer Studie aus Japan ist zu entnehmen, dass Veränderungen der tiefen Hornhautschichten häufiger bei brachycephalen Hunden auftreten. In dieser Studie wurden neben anderen Hunderassen auch 1734 Augen von Shih Tzus untersucht, von denen 290 eine ulcerative Keratitis aufwiesen. Die meisten Hunde wurden im Alter von unter 3 Jahren mit der Erkrankung vorgestellt. Mehr als die Hälfte der betroffenen Hunde zeigten tief reichende Hornhautulcerationen vom Grad 2 oder 3 (stromale oder tiefe, bis auf die Descemet-Membran gehende Hornhautgeschwüre). Bei brachycephalen Rassen ist Lagophthalmus (Unfähigkeit, ein Auge oder beide Augen vollständig zu schließen) eine häufige Ursache für eine ulcerative Keratitis, gefolgt von Keratokonjunktivitis sicca. In einer anderen Studie mit 50 Shih Tzus wiesen 84 % der Hunde einen Lagophthalmus auf. Auf Grund des bei dieser Rasse häufig vorliegenden Exophthalmus kommt es durch den unzureichenden Lidschluss zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Tränenfilms, was wiederum durch Austrocknung das Risiko insbesondere für zentral gelegene Ulcerationen innerhalb der Hornhaut erhöhen kann. Eine Studie an 104.233 Hunden kam zu dem Ergebnis, dass Hornhautgeschwüre bei Shih Tzus mit einer Prävalenz von 3,45 % auftreten. Im Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA besaßen Shih Tzus zwischen 2016 und 2021 ein ca. 6-fach erhöhtes relatives Risiko für die Entwicklung von Hornhautulcera im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Rassen.
Ein begünstigender Faktor für Hornhautulcerationen ist neben der Brachycephalie auch das Vorhandensein einer Nasenfalte. Für Hunde mit Nasenfalte (Anmerkung: bei denen Haare die Hornhaut irritieren können) wurde ein fünffach erhöhtes Risiko für Hornhautulzerationen beschrieben. Auch die erweiterte Lidspalte (Makroblepharon, beurteilbar durch die Sichtbarkeit der Sklera) begünstigt Hornhautulcerationen. Die einzelnen Faktoren sind allerdings z. T. miteinander assoziiert und treten parallel auf. Bei brachycephalen Hunden mit einem kraniofazialen Verhältnis < 0,5 ist das Risiko für Hornhautulcerationen sogar zwanzigmal höher als bei nicht-brachycephalen Hunden.
Eine epidemiologische Studie aus Großbritannien ergab für den Shih Tzu einen Anteil von 8,1 % an allen von einer Keratokonjunktivitis sicca betroffenen Rassen und wies ein ca. 13-fach erhöhtes Risiko für die Erkrankung bei der Rasse nach. Dies wird durch eine weitere Studie bestätigt, in welcher der Shih Tzu auf Platz vier der am häufigsten von dieser Krankheit betroffenen Rassen lag. Hier zeigte sich im Vergleich zu anderen Rassen vor allem ein akuter Verlauf und in einigen Fällen führte eine deutlich erhöhte Häufigkeit von ulcerativer Keratitis zu einer Perforation der Hornhaut.
Klinisch zeigen Hunde mit einer Keratokonjunktivitis sicca beispielsweise purulenten Ausfluss, Hyperämie im Bereich der Konjunktiven und Keratitis sowie eine reduzierte Tränenproduktion.
Ähnlich wie andere brachycephale Rassen gehört auch der Shih Tzu zu den prädisponierten Rassen bei der Hornhautpigmentierung. Aufgrund des entzündlichen Geschehens wird diese auch als pigmentäre Keratitis bezeichnet. Neben epithelialen Pigmentgranula im Hornhautepithel können Langerhans-Zellen, dendritische Zellen, epitheliale Umorganisation und Vaskularisation nachgewiesen werden.
Bei Shih Tzus wird häufig eine Epiphora (Tränenträufeln) festgestellt und das Problem entwickelt sich bereits in jungen Jahren. Die Hauptursachen sind die mediale canthale Trichiasis und/oder ein Entropium. Zusätzlich zur Epiphora treten häufig weitere Augenprobleme auf, wie Konjunktivitis oder konjunktivale Hyperämie, Keratitis, pigmentäre Keratitis und in einigen Fällen auch Hornhautgeschwüre. Nach einer medialen Kanthoplastik (Straffung des inneren Lidwinkels) zur Behebung des Entropiums konnten bei allen beobachteten Hunden deutliche Verbesserungen festgestellt werden.
Das Genetics Committee des American College of Veterinary Ophthalmologists (ACVO) führt auch das Entropium beim Shih Tzu als erbliche Augenerkrankung an. Ebenso beschreibt es die progressive Retinaatrophie beim Shih Tzu, die bis zur Erblindung führen kann.
Dem Breed Report für Shih Tzus der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA ist zu entnehmen, dass Augenerkrankungen zwischen 2016 und 2021 die häufigste Ursache für Tierarztbesuche waren und dass im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Rassen das Risiko für eine Entwicklung von Augenerkrankungen, je nach Art der Erkrankung, 4-6-fach erhöht war.
Psychisch:
Aufgrund der veränderten Schädelanatomie des Shih Tzu ist die Rasse häufig von Augenerkrankungen betroffen, die zu chronischem Unwohlsein und Sehbeeinträchtigungen führen können. Nozizeptive afferente Nervenzellen innervieren die Hornhaut. Daher ist zu erwarten, dass Schäden im Auge starke Schmerzen verursachen. O’Neill et al. (2017) schließen daher aus weiteren Veröffentlichungen, dass ulcerative Veränderungen der Cornea starken Einfluss auf das Wohlbefinden der Tiere haben, da sie zu Schmerzen, einer Uveitis, Perforation bis hin zum Verlust des Auges und damit zur (wesentlichen) Beeinträchtigung des Sehvermögens führen können.
Die meisten tiefen Hornhautgeschwüre heilen ohne chirurgischen Eingriff nicht zufriedenstellend ab. Aufgrund schwerer Hornhautvernarbung kann es zum Verlust des Sehvermögens kommen. Eine durch Keratokonjunktivitis sicca verursachte ulcerative Keratitis bedarf einer kontinuierlichen Behandlung, wobei die Heilungsprognose günstig ist. Beim Glaukom leiden betroffene Hunde neben einem potentiellen Verlust des Sehvermögens vor allem an entsprechenden (erheblichen) Schmerzen des Auges.
Belastungskategorie: 3
Chondrodystrophie und Chondrodysplasie inkl. Bandscheibenerkrankungen (IVDD)
(s. auch Merkblatt Nr. 30 Hund Pekingese)
Physisch:
Chondrodystrophie und Chondrodysplasie beschreiben Abnormalitäten des Knorpelwachstums und der Knochenentwicklung. Sie sind durch verkürzte Gliedmaßen gekennzeichnet. Chondrodystrophe Rassen, zu denen auch der Shih Tzu gehört, sind nicht nur durch verkürzte Gliedmaßen gekennzeichnet, sondern auch durch eine chondroide Metaplasie des Nucleus pulposus, die zu vorzeitiger Degeneration und Verkalkung der Bandscheiben (IVDD) führt. In einer Studie an 8.177 Hunden wurde bei Shih Tzus eine vierfach höhere Anfälligkeit für IVDD festgestellt als im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen betroffenen Rassen. Eine Befragung von Halter*innen von im UK Kennel Club registrierten Hunden ergab für den Shih Tzu eine erhöhte Prävalenz von Bandscheibenerkrankungen, ein Ergebnis, dass sich auch anderen Veröffentlichungen entnehmen lässt. Die Veränderungen der Bandscheiben können sowohl im zervikalen als auch im thorakolumbalen Bereich auftreten. Die Teststatistik der Datenbank der OFA weist zusätzlich bei ca. 26% der getesteten Shih Tzus eine Myelopathie aus und ca. 19% dieser Tiere waren Träger der für das Krankheitsbild der IVDD verantwortlichen Genmutation.
Betroffene Hunde zeigen unterschiedlich stark auftretende Schmerzen und neurologische Defizite. Die Klinik tritt meist sehr akut auf, mit Schmerzhaftigkeit und fortschreitender Myelopathie. Eine Übersichtsarbeit fasst die klinischen Symptome je nach Lokalisation zusammen. Sie reichen von leichtem Unbehagen ohne neurologische Defizite bis hin zu Paralysen der betroffenen Gliedmaßen und Verlust des Empfindens. Die Symptome können akut oder chronisch auftreten. Die histopathologischen und biochemischen Veränderungen bei Bandscheibendegenerationen werden von Smolders et al. (2013) beschrieben.
Psychisch:
Bandscheibenerkrankungen gehen häufig mit Rückenmarksverletzungen einher, die einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität haben können und mit starken Schmerzen für die Tiere verbunden sind. Chronische Patienten vor allem mit Paraplegie (die untere Körperhälfte – Beine, Gesäß, Bauch- und unterer Brustbereich – sind von Querschnittlähmung betroffen) müssen aufgrund ihrer enormen Einschränkungen (Verlust der Mobilität sowie Inkontinenz) zeit- und kostenintensiv von den Tierhalter*innen gepflegt und versorgt werden.
Belastungskategorie: 3
Herzklappenerkrankungen
Physisch:
Für den Shih Tzu ist eine Prädisposition für degenerative Veränderungen der Herzklappen bekannt. Eine retrospektive Studie in einer Klinik in Großbritannien kam zu dem Ergebnis, dass beim Shih Tzu das Risiko für eine degenerative Mitralklappeninsuffizienz im Vergleich zu Mischlingshunden ca. 3-fach erhöht war. In weiteren Studien lagen die Prävalenzen für Mitralklappeninsuffizienz beim Shih Tzu zwischen 12 und 23%. In einer retrospektiven Auswertung wiesen Shih Tzus mit einer Mitralklappeninsuffizienz zudem mit einer Inzidenz von 3,5% Rupturen der Chordae tendineae auf.
Typischerweise ist bei bestimmten prädisponierten Hunderassen ein systolisches, plateauförmiges Herzgeräusch zu hören. Die Erkrankung verläuft oft lange Zeit ohne Symptome. Erste Anzeichen sind die einer Linksherzinsuffizienz. Der Hund wird dann häufig wegen schneller oder schwerer Atmung, Husten oder Ohnmachtsanfällen vorgestellt. Der Husten ist meist hart und trocken, kann aber allmählich häufiger auftreten und ist ein Hinweis auf ein Lungenödem oder eine Verengung der Hauptbronchien, die durch eine vergrößerte linke Herzkammer verursacht werden kann.
Dyspnoe kann auch durch Flüssigkeitsansammlungen in der Brusthöhle (Pleuraerguss) oder im Bauchraum (Aszites) verursacht werden, was auf eine Rechtsherzinsuffizienz hinweist. Diese Form der Herzschwäche ist ein Zeichen für eine fortschreitende Mitralklappenerkrankung und pulmonale Hypertonie, die auch mit einer Degeneration des Trikuspidalklappen-Ventrikels verbunden sein kann. Die Symptome entwickeln sich entweder allmählich und verschlechtern sich langsam oder treten plötzlich auf, etwa bei einer Verschlechterung der Erkrankung. Eine plötzliche Verschlechterung kann durch einen Riss der Chordae tendineae, durch das Auftreten von Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern oder durch Stresssituationen ausgelöst werden.
Im Breed Report der schwedischen Tierkrankenversicherung AGRIA besaßen Shih Tzus zwischen 2016 und 2021 ein 2-fach erhöhtes relatives Risiko für die Entwicklung von Herzerkrankungen im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Rassen.
Psychisch:
Betroffene Hunde können durch die Dyspnoe und Belastungsintoleranz deutlich eingeschränkt sein und daher ihr artgemäßes Verhaltensrepertoire nicht angemessen ausüben. Die mit der Belastungseinschränkung ggf. einhergehende Atemnot führt zu Angst, weil diese als lebensbedrohlich empfunden wird. Angstzustände werden als Leiden gewertet.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägungsgrad
Gebiss- und Zahnfehlstellungen sowie Erkrankungen des Zahnhalteapparats
Physisch:
Aufgrund der strukturellen Veränderungen des brachycephalen Schädels ist es wahrscheinlich, dass jedes brachycephale Gebiss mehrere dentale Anomalien aufweist, die in ihrer relativen Schwere und ihrem Verlauf variieren. Es ist schwierig, diese Anomalien isoliert zu betrachten, da es viele Wechselwirkungen zwischen oralen und dentalen Strukturen gibt.
Beim Shih Tzu treten Zahnerkrankungen und -fehlstellungen gehäuft auf. Durch die brachycephale Konformation mit stark verkürztem Oberkiefer ist oft nicht genügend Platz vorhanden, um die normale Anzahl von 20 Zähnen (je 10 auf jeder Seite) in der richtigen Position und im richtigen Abstand unterzubringen. Dies führt zu Engstand/Gedränge und Rotation der Zähne, besonders bei Hunden kleiner brachycephaler Rassen und in der Folge zur Malocclusion.
Verschiedenen Quellen kann eine Prädisposition des Shih Tzu für eine Malocclusion des Gebisses und für fehlende Zähne entnommen werden. Bei der Malocclusion handelt es sich um eine Zahnfehlstellung, bei der die Zähne nicht korrekt ineinandergreifen. Sie kann genetisch bedingt sein oder durch unglückliche Umstände wie Verletzungen verursacht werden. Malocclusionen können zu Problemen wie Zahnfleischentzündungen, Beschwerden beim Fressen und schmerzhaften Einbissen in den Gaumen führen. Vereinzelt kann dies zu einer Pulpanekrose oder zum Absterben der Zahnpulpa führen. Durch die divergierenden Kieferlängen oben und unten kommt es zu einem unphysiologischen Kontakt von Zähnen im Oberkiefer mit Zähnen oder Zahnfleisch im Unterkiefer. Im Hundemaul sollte es nur dort Kontakt geben, wo die beiden Oberkiefer-Molaren gegen das distale Drittel des ersten Unterkiefer-Molaren sowie des zweiten und dritten Unterkiefer-Molaren stoßen. Alle anderen Kontakte zwischen den Zähnen sind ggf. problematisch und stellen eine Abweichung dar. Außerdem sollte das Zahnfleisch die Zähne nicht überwuchern.
Die veränderte und komprimierte Anatomie des Gesichtsschädels führt bei brachycephalen Tieren, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und Entwicklungsgrad, durch die oben beschriebenen Abweichungen vom normalen Gebisszustand zu damit verbundenen parodontalen Erkrankungen. Parodontalerkrankungen gehören zu den häufigsten Diagnosen bei Hunden in der tierärztlichen Praxis. Einige prospektive Studien berichten Prävalenzraten zwischen 44 % und 63,6 %. Parodontitis gilt als irreversibel und führt zu Schäden am parodontalen Ligament, Zement und Alveolarknochen, was häufig zum Verlust von Zähnen führt. Hauptsächlich entstehen diese Probleme, weil die normalerweise die Zähne umschließende Gingiva – die physikalische Barriere zwischen den Bakterien in der Maulhöhle und den Kieferknochen, die die Zahnwurzeln halten – dabei nicht mehr intakt ist.
In einer umfassenden britischen Studie zu caninen Parodontalerkrankungen lag die Periodenprävalenz beim Shih Tzu bei 9,31 %. Weitere Studien zeigen Prävalenzen von Zahnerkrankungen und Parodontalerkrankungen bei dieser Rasse von etwa 10 % .
Nicht durchbrechende Zähne und odontogene Zysten können bei allen Hunden vorkommen, treten bei brachycephalen Tieren aber deutlich häufiger auf. Auch kleine und sehr kleine Rassen scheinen für nicht durchbrechende Zähne mit und ohne Zysten prädisponiert zu sein. Der Shih Tzu gehört beiden Kategorien an und ist daher häufig überrepräsentiert für diese Erkrankungen. In einer retrospektiven Auswertung von dentalen Röntgenbildern waren Shih Tzus die am dritthäufigsten von odontogenen Zysten betroffene Rasse. Odontogene Zysten sind flüssigkeitsgefüllte Strukturen, die sich über der Krone von Zähnen bilden können, die nicht durchgebrochen sind.
In einer weiteren Studie waren Shih Tzus ebenfalls als dritthäufigste Rasse mit 15,4% von beiden Zahnanomalien betroffen. Die OFA-Teststatistik weist für den Shih Tzu eine Prävalenz für Dentitionskrankheiten von ca. 12% aus.
Psychisch:
Zahnerkrankungen und schmerzhafte Erkrankungen der Maulschleimhäute können erhebliche Einflüsse auf das Wohlbefinden der Tiere haben.
Es ist wichtig zu wissen, dass Hunde – ähnlich wie Katzen – Schmerzen im Maulbereich oft nicht offen zeigen. Selbst bei erheblichen Problemen oder Erkrankungen verweigern sie manchmal nicht die Nahrungsaufnahme, weil ihr Überlebensinstinkt sehr stark ist. Das bedeutet, dass Schmerzen und Leiden vorhanden sein können, ohne dass die Halter dies sofort bemerken. Eine Einschränkung der ungestörten Nahrungsaufnahme wird als nicht unwesentliche Einschränkung des Wohlbefindens gewertet.
Belastungskategorie: 2-3 je nach Ausprägungsgrad
Lebenserwartung und Mortalität
Die Lebenserwartung von brachycephalen Rassen ist im Vergleich zu meso- und dolichocephalen Hunden reduziert. Als Gründe dafür werden die mit der Brachycephalie assoziierten Prädispositionen für BOAS, Wirbelsäulenerkrankungen und weitere Auffälligkeiten diskutiert. Daten der AGRIA-Versicherung für 2016-2021 zeigen, dass die Mortalität bei Shih Tzus aufgrund von Herz- und Nieren- bzw. Harnwegserkrankungen im Vergleich zum Durchschnitt der anderen versicherten Rassen deutlich erhöht war. Das durchschnittliche Alter dieser Tiere zum Zeitpunkt des Todes betrug 8,7 Jahre, während die durchschnittliche Lebenserwartung beim Shih Tzu von verschiedenen Autoren mit 11 bis 13 Jahren angegeben wird.
Tierethische Bewertung der Qualzuchtproblematik beim Shih Tzu
Auf Basis der im vorliegenden QUEN-Merkblatt genannten Fakten, welche die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von zuchtbedingten Defekten der Belastungskategorien 2-3 (mittlere bis starke Belastung) bzw. 3 (starke Belastung) auflisten, ist aus tierethischer Sicht festzustellen, dass die Weiterzucht mit betroffenen Tieren dieser Rasse als höchst problematisch einzustufen ist, da ein Züchter davon ausgehen muss, dass Tiere, die er durch seine Zucht in die Welt setzt, erheblich und andauernd Schmerzen ertragen müssen oder leiden werden. Dies ist bereits dann inakzeptabel, wenn zumindest einer der im gegenständlichen Merkblatt genannten zuchtbedingten Defekte in den Belastungskategorien 2-3 bei mindestens einem der von ihm gezüchteten Tiere in vorhersehbarer Weise eintritt, wobei „vorhersehbar“ erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann vorliegen, wenn sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen erwartbar auftreten.
6. Vererbung, Genetik, ggf. bekannte Gen-Teste, ggf. durchschnittlicher genomischer Inzuchtkoeffizient (COI) für die Rasse
Brachycephalie (s. auch Merkblatt Nr. 8 Hund Brachycephalie)
Die verantwortlichen Gene sind bei dieser Rasse nicht vollständig geklärt. Aufgrund der genetischen Komplexität wird angenommen, dass verschiedene Chromosomen einen Einfluss haben. Die genetischen und entwicklungsbedingten Grundlagen der Brachycephalie sind komplex und umfassen mehrere Genregulationsnetzwerke, wechselseitige Signalinteraktionen sowie hierarchische Kontrollebenen. Mehrere Studien fanden Zusammenhänge mit dem CFA1-Chromosom (Chromosom 1 des Hundes), auf welchem mit Brachycephalie assoziierte Loci liegen. Es wurde vermutet, dass das TCOF1-Gen an der Ausbildung der Brachyzephalie beteiligt ist. Diese Vermutung konnte nicht bestätigt werden. Auch eine Beteiligung der Gene SMOC2, BMP3, FGFR2, THBS1 und DVL2 wird diskutiert.
Chondrodysplasie und Chondrodystrophie (s. auch Merkblatt Nr. 30 Hund Rasse Pekingese)
Die genetische Grundlage der vorzeitigen Degeneration der Bandscheiben (Intervertebral Disc Disease, IVDD) ist die Überexpression des FGF4-Retrogens auf Chromosom 12 (CFA12). Dieses CFA12-FGF4-Retrogen ist bei vielen Hunderassen, die zu vorzeitiger IVDD neigen, in sehr hoher Frequenz vorhanden. Das CFA12-FGF4-Retrogen führt zu einer 20-fachen Erhöhung der FGF4-Expression in der Bandscheibe, was bei betroffenen Hunden bereits im Alter von 10 Wochen zu vorzeitiger chondroider Metaplasie und Degeneration des Nucleus pulposus führt.
Ein separates FGF4-Retrogen auf Chromosom 18 (CFA18) wird mit Skelettdysplasie und unverhältnismäßigem Zwergwuchs in Verbindung gebracht, scheint aber nicht direkt zur Entwicklung von IVDD beizutragen. Viele für IVDD anfällige Rassen tragen sowohl das CFA12- als auch das CFA18-FGF4-Retrogen, was es schwierig macht, den relativen Beitrag jedes einzelnen zum Krankheitsphänotyp vollständig zu analysieren. Das CFA12-FGF4-Retrogen allein scheint jedoch ausreichend, um eine vorzeitige Degeneration der Bandscheiben zu verursachen. Ein Gentest ist verfügbar.
Herzklappenerkrankungen
Die genauen genetischen Ursachen der Mitralklappenerkrankung sind bisher noch nicht vollständig erforscht. Studien haben jedoch gezeigt, dass verschiedene Gene und microRNAs bei gesunden und erkrankten Hunden unterschiedlich exprimiert werden, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise an der Entstehung der Krankheit beteiligt sind. Da kleine Rassen mit einem Körpergewicht von unter 10 kg überrepäsentiert sind, wird eine Beteiligung des IGF1-Gen, das sowohl an der Entwicklung des Herzens als auch der Körpergröße beteiligt ist, diskutiert. Ein Gentest ist nicht verfügbar.
Augenerkrankungen
Bei Shih Tzus wurde eine genetische Variante im JPH2-Gen (Junctophilin) identifiziert, die möglicherweise mit einer progressiven Retinaatrophie (PRA) in Verbindung steht.
Gebiss- und Zahnfehlstellungen sowie Erkrankungen des Zahnhalteapparats
Diese sind durch die veränderte oder gestauchte Anatomie des Gesichtsschädels bedingt und brachycephale Tiere sind daher häufig betroffen. Die dentalen Abweichungen vom physiologischen Zustand treten zwar in unterschiedlichem Ausmaß und in verschiedenen Stadien auf, sind aber typisch für die brachycephale Konformation des Gesichtsschädels und gehen oft mit Erkrankungen des Zahnhalteapparates (Peridontitis) einher.
Weitere verfügbare Gentests für die Rasse
Makrothrombozytopenie (MTC)
Präkallikrein-Defizienz (KLK)
Progressive Retinaatrophie (JPH2-PRA)
Robinow-like-Syndrom (DVL2)
Grundlage einer verantwortungsvollen Zucht ist bei der sorgfältigen Diagnose des Einzeltieres nicht nur die Beurteilung des Exterieurs und der Verhaltenseigenschaften der Zuchtpartner vor dem ersten Zuchteinsatz, sondern auch die Nutzung moderner molekulargenetischer Diagnostik. Innerhalb eines Screenings sollte diese nicht nur zur Identifizierung von Merkmals- oder Anlageträgern, sondern auch zur Bestimmung des Inzuchtgrades des Einzeltieres genutzt werden. Inzwischen bieten Labore sogenannte „Matching Tools” oder „Mating Scores“ an, welche Züchter nutzen können, um geeignete Zuchtpartner zu identifizieren, wobei gleichzeitig die Verpaarung von Tieren mit gleichen risikobehafteten Anlagen verhindert werden kann. Verschiedene spezialisierte Labore bieten für Züchter entsprechende Beratungen an.
7. Diagnose-notwendige Untersuchungen vor Zucht oder Ausstellungen
Achtung: Invasive, das Tier belastende Untersuchungen sollten nur in begründeten Verdachtsfällen bei Zuchttieren durchgeführt werden und nicht, wenn bereits sichtbare Defekte zum Zucht- und Ausstellungsverbot führen.
Brachycephalie
Neben der Anamnese und der allgemeinen Untersuchung können verschiedene bildgebende Verfahren und funktionelle Untersuchungsmethoden zur Diagnostik der Brachycephalie herangezogen werden. Das Brachycephalensyndrom kann mittels bildgebender Verfahren genauer diagnostiziert werden und es können kraniometrische Messungen vorgenommen werden. Die oberen Atemwege lassen sich mittels CT und Endoskopie darstellen. Mittels Endoskopie können Stenosen, Verengungen im Nasenvorhof, Überlänge und Verdickung des weichen Gaumens, Veränderungen der Luftröhre sowie übermäßiges Gewebe im Nasen-/Rachen-/Maulraum festgestellt werden. Neben der bereits adspektorisch feststellbaren Veränderung von Kopfform, Nasenlöchern und Kiefer bringen Röntgenaufnahmen und/oder ein mehrdimensionales bildgebendes Verfahren (Schädel-CT), Klarheit über mögliche weitere Defekte. Eine praxisrelevante Methode der Schädelvermessung wurde mit dem Ampelsystem in den Niederlanden entwickelt. Verboten ist dort die Zucht bei einer relativen nasalen Verkürzung mit einem kraniofazialen Verhältnis von weniger als 0,3, d.h. die Nasenlänge muss mindestens ⅓ der Gesamtkopflänge ausmachen.
BOAS (Brachycephales Obstruktives Atemwegssyndrom)
Bei stabilen Patienten sollte die Lungenfunktion mittels Auskultation, Pulsoxymetrie und Blutgasanalyse überprüft werden. Pneumonien und Lungenödeme können röntgenologisch diagnostiziert werden. Es wird eine klinische Untersuchung inklusive Anamnese durchgeführt. In Narkose wird eine genauere Untersuchung des oropharyngealen und laryngealen Bereiches vorgenommen. Röntgenaufnahmen und weiterführende bildgebende Verfahren wie MRT ermöglichen eine zusätzliche Beurteilung der Atemwege. Die Schwere der Erkrankung (BOAS) kann zusätzlich mittels eines zertifizierten Fitnesstests eingeschätzt werden.
Augenerkrankungen
Zur Diagnostik von Augenerkrankungen dient eine vollständige ophthalmologische Untersuchung, inklusive – je nach Verdachtsdiagnose – Schirmer-Tränentest, Tonometrie, Tränenfilmtonometrie, Spaltlampenuntersuchung und Gonioskopie. Bei Verdacht auf infektiöse Erkrankungen, wie bakterielle Keratitis, sind Bakterienkulturen anzulegen. Eine Keratokonjunktivitis sicca kann durch Ultraschalluntersuchung der Tränendrüsen verifiziert werden.
Chondrodystrophie und Chondrodysplasie inkl. Bandscheibenerkrankungen
Adspektorisch ist die Beurteilung des äußeren Erscheinungsbildes entscheidend. Röntgenologisch können die Knochen und Wachstumsfugen genauer beurteilt werden. Zur ersten Einschätzung bei Bandscheibenerkrankungen wird die Anamnese erhoben und eine neurologische Untersuchung durchgeführt. Bildgebende Verfahren, wie MRT, CT und Myelographie, sind zur Bestimmung der Lokalisation eines Bandscheibenvorfalls geeignet und die betroffenen Bereiche können genauer untersucht und beurteilt werden.
Herzklappenerkrankungen
Eine Verdachtsdiagnose für eine Herzerkrankung kann durch Auskultation des Herzens gestellt werden. Die Echokardiographie ist das wichtigste Verfahren, um Herz- und Gefäßerkrankungen genau zu diagnostizieren. Zusätzlich können eine Blutdruckmessung und Röntgenaufnahmen helfen, den Herzschatten zu beurteilen und mögliche Veränderungen in der Lunge zu erkennen. Auch kardiale Biomarker können für eine Diagnose herangezogen werden. Es kann eine Einteilung in verschiedene Stadien und Schweregrade erfolgen. Die Speckle-Tracking-Echokardiographie (STE) ermöglicht eine noch genauere Beurteilung der Herzfunktion und gibt Hinweise darauf, ob eine bestehende Mitralklappeninsuffizienz sich verschlechtert und das Herz dadurch belastet wird.
Gebiss- und Zahnfehlstellungen sowie Erkrankungen des Zahnhalteapparats
Neben einer visuellen Beurteilung der Zähne und des Gebisses sind bildgebende Verfahren hilfreich. Während herkömmliche Dentalröntgenaufnahmen möglich sind, bieten Cone-Beam-Tomographien (Dental CBCT) aufgrund der Veränderungen im Schädel bei brachycephalen Rassen eine genauere Beurteilung. Eine gründliche Untersuchung der Maulhöhle ist ohne Vollnarkose oft schwierig, weil die meisten betroffenen Hunde bei Berührung der Mundschleimhaut Schmerzen zeigen. Zur Beurteilung des Parodontalstatus sollten Röntgenbilder angefertigt werden. Bei nicht durchbrechenden Zähnen ist eine intraorale Röntgenuntersuchung des Gebisses ratsam, um mögliche Zysten oder andere Probleme zu erkennen.
8. Aus tierschutzfachlicher Sicht notwendige oder mögliche Anordnungen
Entscheidungen über Zucht- oder Ausstellungsverbote sollten im Zusammenhang mit der Belastungskategorie (BK) getroffen werden. Ausschlaggebend für ein Zuchtverbot kann je nach Ausprägung und Befund der schwerste, d.h. das Tier am meisten beeinträchtigende Befund und dessen Einordnung in eine der Belastungskategorien (BK) sein, oder auch die Zusammenhangsbeurteilung, wenn viele einzelne zuchtbedingte Defekte oder rassetypische Prädispositionen vorliegen. Berücksichtigt werden sollte ggf. auch der individuelle genomische Inzuchtkoeffizient eines Tieres und die Eigenschaft als Trägertier für Risiko-Gene.
Generell sollte auch bei der Zucht von Shih Tzus beachtet werden:
Neben zu beachtenden äußerlichen, anatomischen und funktionellen Merkmalen sowie des Verhaltens beider Zuchtpartner, sollten die Möglichkeiten zuchthygienischer Beratung auf molekulargenetischer Ebene genutzt werden und insbesondere der genetische Inzuchtkoeffizient, der Heterozygotiewert und die Dog Leukocyte Antigene (DLA) für die Rasse bestimmt werden. In zunehmendem Maß können auch sogenannte Matching Tools/Scores die Auswahl geeigneter Zuchtpartner erleichtern.
a) notwendig erscheinende Anordnungen
Zuchtverbot gem. § 11b TierSchG für Tiere mit vererblichen/zuchtbedingten Defekten, insbesondere
- mit Veränderungen des Skelettsystems: Kopf, Wirbelsäule, ggf. Hüfte, Becken
- mit brachycephalem obstruktivem Atemwegs-Syndrom (BOAS)
- mit deutlich verkürztem Oberkiefer, Fehlstellungen der Zähne (insbesondere sichtbare Zähne bei geschlossenem Maul) oder Malokklusion, Fehlen oder Rotation mehrerer Molaren
- mit das Sehvermögen beeinträchtigenden oder vererblichen Augenerkrankungen
- mit das Leistungsvermögen einschränkenden oder vererblichen Herzerkrankungen
Ausstellungsverbot gem. § 10 TierSchHuV mindestens bei Merkmalen/Symptomen der Belastungskategorie 3.
b) mögliche Anordnungen
- Anordnung zur dauerhaften chirurgischen Unfruchtbarmachung (Sterilisation/ Kastration) gemäß § 11b (2) TierSchG
- Anordnung von Gen-Testen zur Bestimmung des genomischen Inzuchtkoeffizienten und Heterozygotie-Wertes beider ggf. zur Zucht vorgesehener Tiere
- Nutzung zuchthygienischer Beratung und ggf. so genannter Matching Tools zur Vermeidung ungeeigneter Verpaarungen.
c) Anfragen und Anordnungen (im Rahmen einer Gefahrerforschungsmaßnahme) vor Erteilung einer Zuchtgenehmigung:
- Zuchtverband/Verein
- Züchter
- Populationsgröße der Rasse im Verein/Verband
- Derzeit gültiger Rassenstandard und Zuchtordnung
- Forderungen im Standard / Anatomische Merkmale, die für Krankheiten prädisponieren
- Genomischer (nicht berechneter) Inzuchtkoeffizient des Tieres / der Rasse
- Diversität (HET, DLA)
- Durchschnittlich erreichtes Lebensalter
- Häufigste Todesursache
- Durchschnittliche Wurfgröße
- Welpensterblichkeit
- Anzahl tierärztlicher Interventionen zur Geburtshilfe / Kaiserschnitte insgesamt
Untersuchungen
- freiwillig durchzuführende Untersuchungen
- verpflichtend vor Zuchtverwendung durchzuführende Untersuchungen
Gen-Teste (welche sind verfügbar und für die Rasse verifiziert?)
- freiwillig durchgeführte Gen-Teste
- verpflichtend vor Zuchtverwendung durchzuführende Gen-Teste
Bitte beachten:
Maßnahmen der zuständigen Behörde müssen erkennbar geeignet sein, auch in die Zukunft wirkend Schaden von dem betroffenen Tier und/oder dessen Nachzucht abzuwenden. Es handelt sich im Hinblick auf Art und Bearbeitungstiefe von Anordnungen und Zucht- oder Ausstellungsverboten immer um Einzelfallentscheidungen im Ermessen der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung der aktuellen rechtlichen Normen und der vor Ort vorgefundenen Umstände.
9. Allgemeine tierschutzrechtliche Bewertung
a) Deutschland
Aus rechtlicher Sicht sind Hunde mit den oben beschriebenen Defekten/ Syndromen in Deutschland gemäß §11b TierSchG als Qualzucht einzuordnen.
Begründung:
Gem. § 11b TierSchG ist es verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge der Zucht bei der Nachzucht oder den Nachkommen u.a.
- erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 1 TierSchG) oder
- mit Leiden verbundene erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten (§ 11b Abs. 1 Nr. 2 a) TierSchG) oder
- die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt (§ 11b Abs. 1 Nr. 2 c) TierSchG).
Schmerz definiert man beim Tier als unangenehme Sinneswahrnehmung, verursacht durch tatsächliche oder potentielle Verletzung, die motorische oder vegetative Reaktionen auslöst, in einem erlernten Vermeidungsverhalten resultiert und potentiell spezifische Verhaltensweisen verändern kann (Hirt/Maisack/Moritz/Felde, TierSchG, Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 12 mwN; grds. auch Lorz/Metzger TierSchG 7. Aufl. § 1 Rn. 20).
Leiden sind alle nicht bereits vom Begriff des Schmerzes umfassten Beeinträchtigungen im Wohlbefinden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeitspanne fortdauern (Hirt/Maisack/Moritz/Felde Tierschutzgesetz Kommentar 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 19 mwN.; Lorz/Metzger, TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 33 mwN). Auch Leiden können physisch wie psychisch beeinträchtigen; insbesondere Angst wird in der Kommentierung und Rechtsprechung als Leiden eingestuft (Hirt/Maisack/Moritz/Felde § 1 TierSchG Rn. 24 mwN; Lorz/Metzger § 1 TierSchG Rn. 37).
Ein Schaden liegt vor, wenn der körperliche oder seelische Zustand, in welchem ein Tier sich befindet, vorübergehend oder dauernd zum Schlechteren hin verändert wird (Hirt/Maisack/Moritz/Felde TierSchG Komm. 4. Aufl. 2023 § 1 Rn. 27 mwN; Lorz/Metzger TierSchG Komm. 7. Aufl. 2019 § 1 Rn. 52 mwN), wobei völlig geringfügige Beeinträchtigungen, basierend auf körperlicher oder psychischer Grundlage, außer Betracht bleiben. „Der Sollzustand des Tieres beurteilt sich an Tieren der gleichen Art. Das Fehlen von Körperteilen wird dabei in der Kommentarliteratur regelmäßig als Schaden bewertet“ (VG Hamburg Beschl. v. 4.4.2018, 11 E 1067/18 Rn. 47, so auch Lorz/Metzger TierSchG Komm. § 1 Rn. 52).
Die Zucht von Hunden der Rasse Shih Tzu erfüllt den Tatbestand der Qualzucht durch einzelne oder mehrere unter Ziffer 5 im Detail erläuterte Schmerzen, Leiden oder Schäden, insbesondere:
- Schäden an Wirbelsäule, Schädel oder Skelett und damit verbundene Schmerzen und Leiden
- Brachycephalie und ggf. Brachycephales obstruktives Atemwegssyndrom (BOAS)
- Beeinträchtigung der Thermoregulation und damit verbundenes Leiden
- durch Atemnot verursachte Angstzustände
- Augenerkrankungen und damit verbundene Schmerzen und Schäden
- Chondrodystrophie und Chondrodysplasie inkl. Bandscheibenerkrankungen (IVDD)
- Schäden oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und dadurch entstehende Schmerzen und Leiden
- Anomalien an Kiefer und Gebiss und dadurch entstehende Leiden, Schmerzen oder Schäden
Ein Tier mit einer zuchtbedingten Veränderung der Kopfform (ggf. bereits auch begleitet von weiteren sichtbaren Defekten) ist bereits gemäß dem sog. Qualzuchtgutachten (2000) als Qualzucht klassifiziert (vgl. Qualzuchtgutachten, S. 10f.).
Die mit der Brachycephalie einhergehenden Änderungen der anatomischen und physiologischen Verhältnisse sowie die damit zusammenhängenden Begleit- und Folgeerkrankungen (Ziff. 5) führen zu Beeinträchtigungen wesentlicher Lebensbereiche wie Atmung, Schlaf, Futteraufnahme, Spiel, Temperaturregulation und Belastbarkeit und somit zu einer erheblichen Einschränkung von arttypischen Verhaltensweisen der betroffenen Hunde. Dies führt zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und somit zu Leiden i.S.v. § 11b TierSchG bei den entsprechenden Tieren (Hirt in: Hirt/Maisack/Moritz/Felde TierSchG § 1, Rn. 20,22).
Zur ausführlichen rechtlichen Begründung der Einordnung der Brachycephalie als Qualzucht siehe: https://qualzucht-datenbank.eu/merkblatt-hund-brachycephalie/
Das Verbot gilt unabhängig von der subjektiven Tatseite, also unabhängig davon, ob der Züchter selbst die Möglichkeit der schädigenden Folgen erkannt hat oder hätte erkennen müssen (Lorz/Metzger § 11b Rn. 4; Hirt/Maisack/Moritz/Felde TierSchG 4. Aufl. 2023 § 11b Rn. 6). Wegen dieses objektiven Sorgfaltsmaßstabes kann er sich nicht auf fehlende subjektive Kenntnisse oder Erfahrungen berufen, wenn man die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen von einem sorgfältigen Züchter der jeweiligen Tierart erwarten kann.
Vorhersehbar sind erbbedingte Veränderungen bei den Nachkommen auch dann, wenn ungewiss ist, ob sie erst nach einem Generationensprung in späteren Generationen auftreten (vgl. Goetschel in Kluge § 11b Rn. 14; vgl. im Ergebnis auch Lorz/Metzger TierSchG 7. Aufl. 2019 § 11b Rn. 14).
b) Österreich
Hunde mit den o. beschriebenen Defekten/ Syndromen sind in Österreich gemäß §5 TSchG als Qualzucht einzuordnen
Gegen § 5 des österreichischen TschG verstößt insbesondere, wer „Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen“.
Verkürzung des Gesichtsschädels: Die Zucht mit Hunden, die unter einer massiven Verkürzung des Gesichtsschädels und den damit verbundenen Problemen leiden oder dafür genetisch prädestiniert sind, ist jedenfalls dann als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 Abs. 2 Z. 1 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: Atemnot; Fehlbildungen des Gebisses oder des Kiefers, sofern diese Fehlbildungen ihren physiologischen Funktionen entgegenstehen.
Exophthalmus, Entropium: Die Zucht mit Hunden, die unter pathologischen Veränderungen der Augen leiden oder genetisch dafür prädestiniert sind, ist jedenfalls dann als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 Abs. 2 Z. 1 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: Einschränkung physiologischer Funktionen durch Entzündungen oder Missbildungen der Augen bzw. deren Anhangsgebilde, Entzündungen der Lidbindehaut und/oder der Hornhaut, Blindheit, oder wenn die Veränderungen eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen.
Bandscheibenschäden: Die Zucht mit Hunden, die unter Veränderungen der Wirbelsäule leiden oder dafür genetisch prädestiniert sind, ist jedenfalls dann als Qualzucht zu qualifizieren, wenn eines der folgenden in § 5 Abs. 2 Z. 1 aufgezählten Symptome verwirklicht ist: Bewegungsanomalien, Lahmheiten, neurologische Symptome.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Entsprechend der bei der Aufzählung möglicher Defekte gewählten Formulierung „insbesondere“ gehören auch Herzerkrankungen bei den Nachkommen zu den klinischen Symptomen, die nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen.
Schwergeburten/Kaiserschnitte: Die Zucht von Shih Tzus ist bereits aufgrund der Tatsache als Qualzucht zu qualifizieren, dass im Einzelfall mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden muss, dass natürliche Geburten nicht möglich sind.
c) Schweiz
Wer mit einem Tier züchten will, das ein Merkmal oder Symptom aufweist, das im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu einer mittleren oder starken Belastung führen kann, muss vorgängig eine Belastungsbeurteilung vornehmen lassen. Bei der Belastungsbeurteilung werden nur erblich bedingte Belastungen berücksichtigt (vgl. Art. 5 Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten [TSchZV]). Hunde mit Defekten, die der Belastungskategorie 3 zuzuordnen sind, unterliegen gemäß Art. 9 TSchZV einem Zuchtverbot. Ebenso ist es verboten, mit Tieren zu züchten, wenn das Zuchtziel bei den Nachkommen eine Belastung der Kategorie 3 zur Folge hat.
Mit Tieren der Belastungskategorie 2 darf gezüchtet werden, wenn das Zuchtziel beinhaltet, dass die Belastung der Nachkommen unter der Belastung der Elterntiere liegt (Art. 6 TSchZV). Anhang 2 der TSchZV nennt Merkmale und Symptome, die im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu mittleren oder starken Belastungen führen können. Skelettanomalien, degenerative Gelenkveränderungen, Schädeldeformationen mit behindernden Auswirkungen auf die Atemfähigkeit, die Lage der Augen, die Zahnstellung und den Geburtsvorgang, Bandscheibenvorfälle, Fehlfunktionen der Augen sowie Katarakt, die Progressive Retinaatrophie (PRA) und Entropium werden ausdrücklich erwähnt. Zudem werden gemäß Art. 10 TSchZV einzelne Zuchtformen ausdrücklich verboten. In den übrigen Fällen wird ein Zuchtverbot jedoch nur im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung ausgesprochen. Tiere, die aufgrund unzulässiger Zuchtziele gezüchtet wurden, dürfen nicht ausgestellt werden (Art. 30a Abs. 4 Bst. b TSchV).
d) Niederlande
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” des Tierhalter-Dekrets verboten, mit Haustieren in einer Weise zu züchten, die dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Elterntiere oder ihrer Nachkommen abträglich ist.
In jedem Fall muss die Zucht so weit wie möglich verhindern, dass
- schwerwiegende Erbfehler und Krankheiten an die Nachkommen weitergegeben werden oder bei ihnen auftreten können;
- äußere Merkmale an die Nachkommen weitergegeben werden oder sich bei ihnen entwickeln können, die schädliche Folgen für das Wohlbefinden oder die Gesundheit der Tiere haben.
Folgende Erbkrankheiten oder Anomalien gemäß Artikel 3.4. sind beim Shih Tzu verwirklicht: Brachycephalie, Erkrankungen des Auges, Anomalien der Wirbelsäule, Herzklappenerkrankungen, Zahnerkrankungen.
Es können u.a. folgende schädliche äußere Merkmale an die Nachkommen von Shih Tzus weitergegeben werden: kurze Schnauze, kurze Beine, langer Rücken.
Es ist in den Niederlanden gemäß Artikel 3.4. “Zucht mit Haustieren” des Tierhalter-Dekrets und Artikel 2 Satz 1 des Dekrets “Zucht mit brachycephalen Hunden” verboten, Hunde zu züchten, deren Schnauze kürzer als ein Drittel der Schädellänge ist und die weitere der oben genannten damit zusammenhängenden Probleme aufweisen: bei der Atmung in Ruhe ein Nebengeräusch erzeugen; mäßige bis starke Verengung der Nasenöffnungen aufweisen; eine Nasenfalte mit Haaren, die von der Nasenfalte aus die Hornhaut oder Bindehaut berühren oder berühren könnten oder die nass ist; Entzündungszeichen in einem oder beiden Augen, die mit dem Vorhandensein der Nasenfalte zusammenhängen; ein Auge mit in zwei oder mehr Quadranten sichtbarem Augenweiß; ein Augenlid, das beim Auslösen des Lidreflexes nicht vollständig geschlossen werden kann.
Ausführliche rechtliche Bewertungen und/ oder Gutachten können, soweit schon vorhanden, auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden.
10. Relevante Rechtsprechung
- Deutschland: Nicht zum Shih Tzu, aber zu Brachycephalie beim French Bulldog: VG Stade, Beschluss v. 07.07. 2022, 10 B 481/22 und OVG Lüneburg, Beschluss v. 25.10.2022, 11 ME 221722
- Österreich: Nicht bekannt.
- Schweiz: Nicht bekannt.
- Niederlande: Gericht für Zivilrecht Amsterdam, Urteil vom 4.Juni 2025, Verbot der Ausstellung von Ahnentafeln für brachycephale Rassen. Im Urteil wird der Shih Tzu explizit als eine der Rassen genannt, die keinen Stammbaum mehr erhalten, wenn die Eltern nicht den niederländischen Kriterien entsprechen (s.a. https://qualzucht-datenbank.eu/wp-content/uploads/2025/06/Urteil-brachycephale-Hunde-DE-Juni-2025.pdf ).
- Schweden: Nicht bekannt.
- Norwegen: Nicht bekannt.
11. Anordnungsbeispiel vorhanden?
Nein.
Anordnungsbeispiele werden ausschließlich auf Anfrage Veterinärämtern zum dienstlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt.
12. Zuwendungen und Förderungen
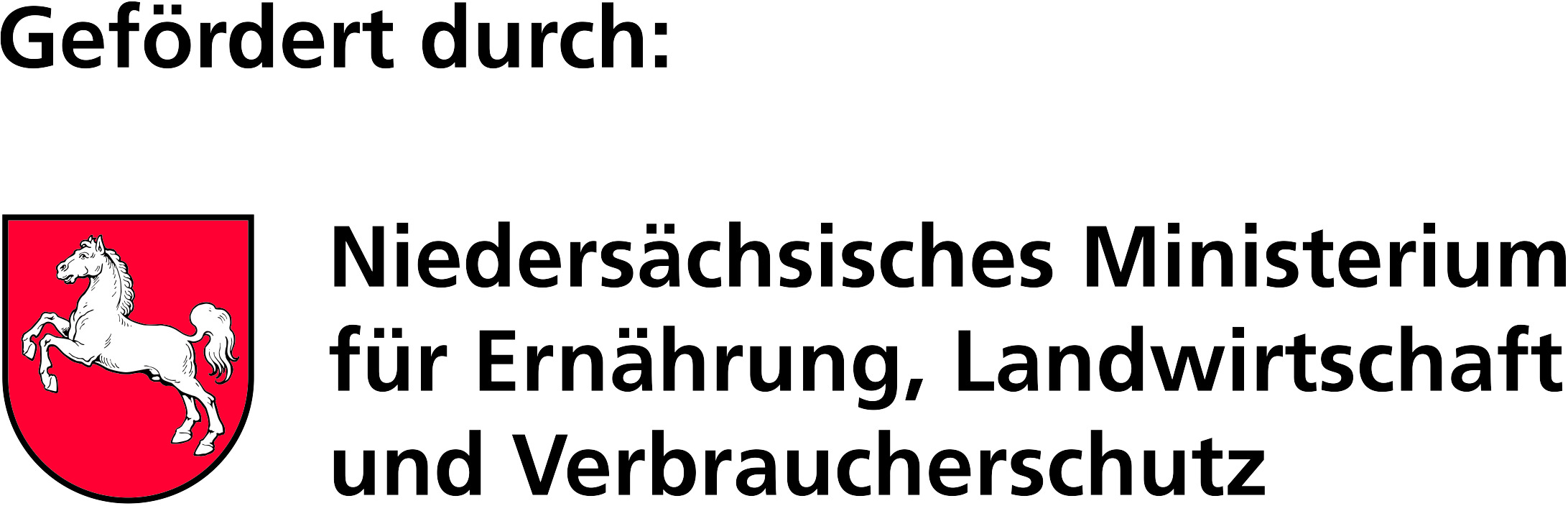
13. Literaturverzeichnis/ Referenzen/ Links
An dieser Stelle wird nur eine Auswahl an Quellen zu den oben beschriebenen Defekten und ggf. allgemeine Literatur zu zuchtbedingten Defekten bei Hunden angegeben. Umfangreichere Literaturlisten zum wissenschaftlichen Hintergrund werden auf Anfrage von Veterinärämtern ausschließlich an diese versendet.
Hinweis: Die Beschreibung von mit dem Merkmal verbundenen Gesundheitsproblemen, für die bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, erfolgen vor dem Hintergrund entsprechender Erfahrungen der Experten und Expertinnen aus der tierärztlichen Praxis, und/oder universitären Einrichtungen, sowie öffentlich frei einsehbaren Datenbanken oder Veröffentlichungen von Tier-Versicherungen und entstammen daher unterschiedlichen Evidenzklassen.
Da Zucht und Ausstellungswesen heutzutage international sind, beziehen sich die Angaben in der Regel nicht nur auf Prävalenzen von Defekten oder Merkmalen in einzelnen Verbänden, Vereinen oder Ländern.
Quellen:
AGRIA Pet Insurance Sweden. (2021). Shih Tzu Agria Breed Profiles Veterinary Care 2016-2021.
Babbitt, S. G., Krakowski Volker, M., & Luskin, I. R. (2016). Incidence of Radiographic Cystic Lesions Associated With Unerupted Teeth in Dogs. Journal of Veterinary Dentistry, 33(4), 226–233. https://doi.org/10.1177/0898756416683490
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). (2015). Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Züchten. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/747/de
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). (2005). Gutachten zur Auslegung von Paragraf 11b des Tierschutzgesetzes (Qualzuchtgutachten). https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Tierschutz/Gutachten-Leitlinien/Qualzucht.html
Dickinson, P. J., & Bannasch, D. L. (2020). Current Understanding of the Genetics of Intervertebral Disc Degeneration. Frontiers in Veterinary Science, 7, 431. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00431
Geiger, M., Schoenebeck, J. J., Schneider, R. A., Schmidt, M. J., Fischer, M. S., & Sánchez-Villagra, M. R. (2021). Exceptional Changes in Skeletal Anatomy under Domestication: The Case of Brachycephaly. Integrative Organismal Biology (Oxford, England), 3(1), obab023. https://doi.org/10.1093/iob/obab023
Genetics Committee of the American College of Veterinary Ophthalmologists, (ACVO). (2023). ACVO 2023 The Blue Book—Ocular disorders presumed to be inherited in purebreed dogs- Shih Tzu (15th Edition). https://ofa.org/chic-programs/browse-by-breed/?breed=SHT
Hale, F. A. (2021). Dental and Oral Health for the Brachycephalic Companion Animal . In Health and Welfare of Brachycephalic (Flat-faced) Companion Animals (1., S. 235–250). Taylor and Francis Group. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429263231-14/dental-oral-health-brachycephalic-companion-animal-fraser-hale
Hirt, A., Maisack, C., Moritz, J., & Felde, B. (2023). Tierschutzgesetz: Mit TierSchHundeV, TierSchNutztV, TierSchVersV, TierSchTrV, EU-Tiertransport-VO, TierSchlV, EU-Tierschlacht-VO, TierErzHaVerbG: Kommentar (4. Auflage). Verlag Franz Vahlen.
Iwashita, H., Wakaiki, S., Kazama, Y., & Saito, A. (2020). Breed prevalence of canine ulcerative keratitis according to depth of corneal involvement. Veterinary Ophthalmology, 23(5), 849–855. https://doi.org/10.1111/vop.12808
Kato, K., Sasaki, N., Matsunaga, S., Nishimura, R., & Ogawa, H. (2006). Incidence of Canine Glaucoma with Goniodysplasia in Japan: A Retrospective Study. Journal of Veterinary Medical Science, 68(8), 853–858. https://doi.org/10.1292/jvms.68.853
Kim, C.-G., Lee, S.-Y., Kim, J.-W., & Park, H.-M. (2013). Assessment of Dental Abnormalities by Full-Mouth Radiography in Small Breed Dogs. Journal of the American Animal Hospital Association, 49(1), 23–30. https://doi.org/10.5326/JAAHA-MS-5830
Kluge, H.-G. (Hrsg.). (2002). Tierschutzgesetz: Kommentar (1. Aufl). Kohlhammer.
Lorz, A., & Metzger, E. (Hrsg.). (2019). Tierschutzgesetz: Mit Allgemeiner Verwaltungsvorschrift, Art. 20a GG sowie zugehörigen Gesetzen, Rechtsverordnungen und Rechtsakten der Europäischen Union: Kommentar (7. Auflage). C.H. Beck.
Mattin, M. J., Boswood, A., Church, D. B., López‐Alvarez, J., McGreevy, P. D., O’Neill, D. G., Thomson, P. C., & Brodbelt, D. C. (2015). Prevalence of and Risk Factors for Degenerative Mitral Valve Disease in Dogs Attending Primary‐care Veterinary Practices in England. Journal of Veterinary Internal Medicine, 29(3), 847–854. https://doi.org/10.1111/jvim.12591
Niederländische Grundsatzregelung für brachycephale Rassen (2023). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2023-23619.pdf
Niederländischer Staatssekretär für Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovation vom 19. Oktober 2012, Nr. 291872, Direktion für Gesetzgebung und Rechtsfragen. (2024). Niederländisches Tierhalter-Dekret. Tierhalter Dekret. https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2024-07-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel3.4
O’Neill, D. G., Lee, M. M., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Sanchez, R. F. (2017). Corneal ulcerative disease in dogs under primary veterinary care in England: Epidemiology and clinical management. Canine Genetics and Epidemiology, 4(1), 5. https://doi.org/10.1186/s40575-017-0045-5
O’Neill, D. G., Pegram, C., Crocker, P., Brodbelt, D. C., Church, D. B., & Packer, R. M. A. (2020). Unravelling the health status of brachycephalic dogs in the UK using multivariable analysis. Scientific Reports, 10(1), 17251. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73088-y
O’Neill, D. G., Mitchell, C. E., Humphrey, J., Church, D. B., Brodbelt, D. C., & Pegram, C. (2021). Epidemiology of periodontal disease in dogs in the UK primary‐care veterinary setting. Journal of Small Animal Practice, 62(12), 1051–1061. https://doi.org/10.1111/jsap.13405
O’Neill, D. G., Brodbelt, D. C., Keddy, A., Church, D. B., & Sanchez, R. F. (2021). Keratoconjunctivitis sicca in dogs under primary veterinary care in the UK: An epidemiological study. Journal of Small Animal Practice, 62(8), 636–645. https://doi.org/10.1111/jsap.13382
Orthopedic Foundation for Animals (OFA). (2025). Shih Tzu Testing Statistics-Hips,Patella,Elbow,Myelopathy, Dentition. https://ofa.org/chic-programs/browse-by-breed/?breed=SHT
Priester, W. A. (1976). Canine intervertebral disc disease—Occurrence by age, breed, and sex among 8,117 cases. Theriogenology, 6(2–3), 293–303. https://doi.org/10.1016/0093-691X(76)90021-2
Sanchez, R. F., Innocent, G., Mould, J., & Billson, F. M. (2007). Canine keratoconjunctivitis sicca: Disease trends in a review of 229 cases. Journal of Small Animal Practice, 48(4), 211–217. https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2006.00185.x
Schweizerischer Bundesrat. (2024). Tierschutzverordnung (TSchV) Schweiz. FedLex. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/de
Scott, E. M., Esson, D. W., Fritz, K. J., & Dubielzig, R. R. (2013). Major breed distribution of canine patients enucleated or eviscerated due to glaucoma following routine cataract surgery as well as common histopathologic findings within enucleated globes. Veterinary Ophthalmology, 16(s1), 64–72. https://doi.org/10.1111/vop.12034
Sebbag, L., Silva, A. P. S. M., Santos, Á. P. B., Raposo, A. C. S., & Oriá, A. P. (2023). An eye on the Shih Tzu dog: Ophthalmic examination findings and ocular surface diagnostics. Veterinary Ophthalmology, 26(S1), 59–71. https://doi.org/10.1111/vop.13022
Sebbag, L., & Sanchez, R. F. (2023). The pandemic of ocular surface disease in brachycephalic dogs: The brachycephalic ocular syndrome. Veterinary Ophthalmology, 26(S1), 31–46. https://doi.org/10.1111/vop.13054
Serres, F., Chetboul, V., Tissier, R., Sampedrano, C. C., Gouni, V., Nicolle, A. P., & Pouchelon, J. (2007). Chordae tendineae Rupture in Dogs with Degenerative Mitral Valve Disease: Prevalence, Survival, and Prognostic Factors (114 Cases, 2001–2006). Journal of Veterinary Internal Medicine, 21(2), 258–264. https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2007.tb02958.x
Smolders, L. A., Bergknut, N., Grinwis, G. C. M., Hagman, R., Lagerstedt, A.-S., Hazewinkel, H. A. W., Tryfonidou, M. A., & Meij, B. P. (2013). Intervertebral disc degeneration in the dog. Part 2: Chondrodystrophic and non-chondrodystrophic breeds. The Veterinary Journal, 195(3), 292–299. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2012.10.011
Tolar, E. L., Hendrix, D. V. H., Rohrbach, B. W., Plummer, C. E., Brooks, D. E., & Gelatt, K. N. (2006). Evaluation of clinical characteristics and bacterial isolates in dogs with bacterial keratitis: 97 cases (1993–2003). Journal of the American Veterinary Medical Association, 228(1), 80–85. https://doi.org/10.2460/javma.228.1.80
Wiles, B. M., Llewellyn-Zaidi, A. M., Evans, K. M., O’Neill, D. G., & Lewis, T. W. (2017). Large-scale survey to estimate the prevalence of disorders for 192 Kennel Club registered breeds. Canine Genetics and Epidemiology, 4(1), 8. https://doi.org/10.1186/s40575-017-0047-3
Dieses Merkblatt wurde durch die QUEN gGmbH unter den Bedingungen der „Creative Commons – Namensnennung – Keine kommerzielle Nutzung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ – Lizenz, in Version 4.0, abgekürzt „CC BY-NC-SA 4,0“, veröffentlicht. Es darf entsprechend dieser weiterverwendet werden, Eine Kopie der Lizenz ist unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ einsehbar. Für eine von den Bedingungen abweichende Nutzung wird die Zustimmung des Rechteinhabers benötigt.
Sie können diese Seite hier in eine PDF-Datei umwandeln:









